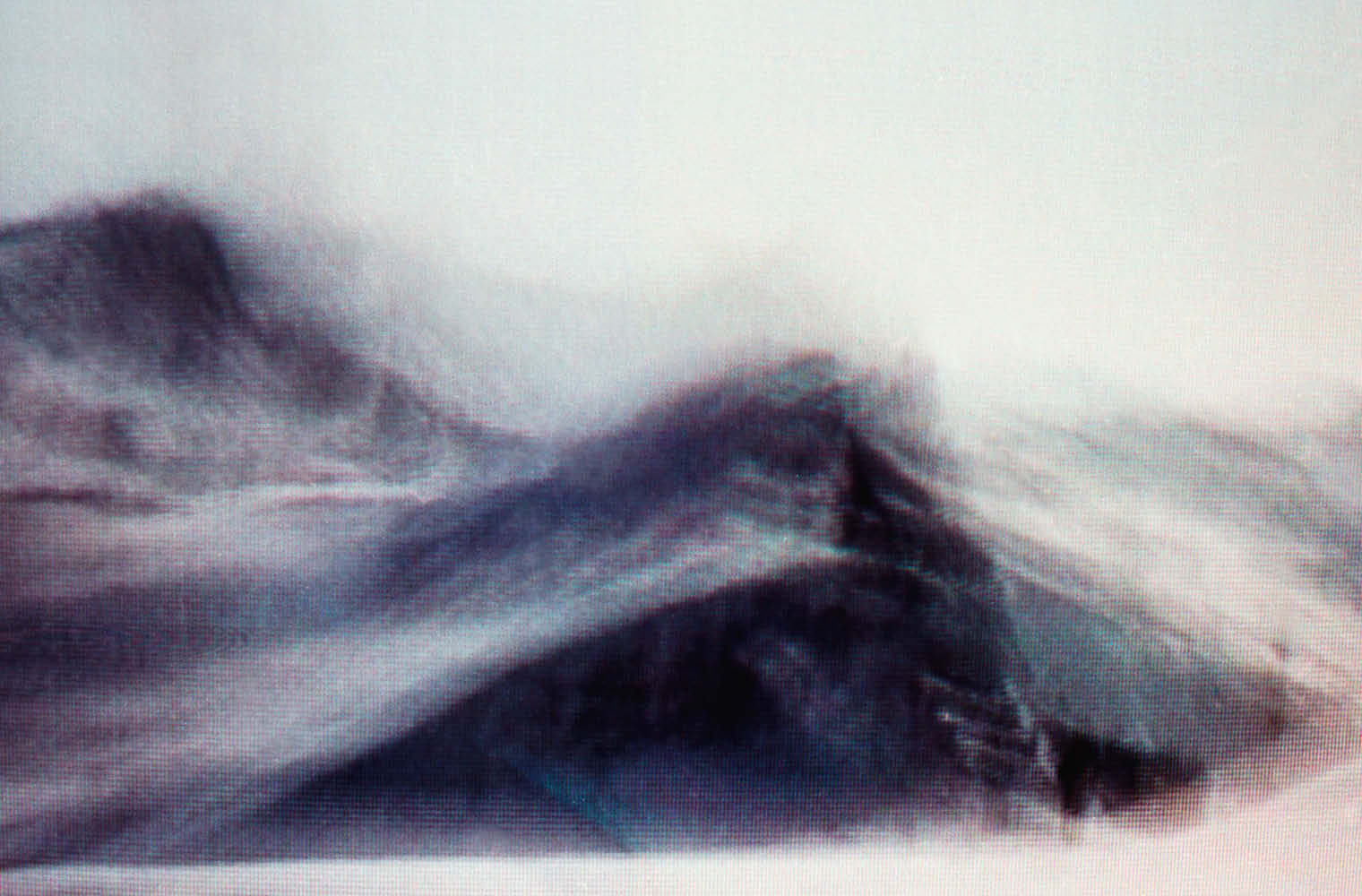
Rika Krithara, Moving Mountain, Videostill, 2023, s. S. 33
Soziale Isolation, Einsamkeit und psychische Entwicklung
Seit der Covid-19-Pandemie ist das Problembewusstsein für Bedingungen sozialer Isolation, fehlender Kontakte zu anderen Menschen oder das Gefühl von Einsamkeit erheblich gewachsen. Ich würde diese Situation gerne nutzen, um auf einen gesellschaftlichen Zustand aufmerksam zu machen, der schon vor der Pandemie vernachlässigt wurde und jetzt viel zu schnell wieder in den Hintergrund gedrängt wird.
Denn obwohl ein großer Teil der Menschen in den letzten Jahren Phasen der sozialen Isolation als psychisch zermürbend oder sogar krankmachend erlebt hat, wird in der Konsequenz immer noch zu wenig darüber gesprochen, wie man Bedingungen der sozialen Isolation für diejenigen Menschen verbessert, die schon vor den allgemeinen Quarantänemaßnahmen davon betroffen waren und es auch weiterhin in besonderem Maße sind. Dies betrifft nicht nur die Situation von Menschen in Heimerziehung, Haftanstalten oder Pflege- und Behinderteneinrichtungen, sondern auch Kinder- oder Altersarmut, Arbeitslosigkeit und chronische Erkrankungen. Überall dort, wo zwischenmenschliche Beziehungen nicht vorhanden, nicht dauerhaft, stressbelastet, zurückweisend, unverlässlich oder aber ausschließlich professionell gestaltet sind, kommt es für das Individuum zu entsprechend isolierenden Bedingungen. Verschärft wird diese Problematik zusätzlich noch dadurch, dass soziale Isolation insbesondere Menschen in vulnerablen Lebenslagen trifft und derart negative Auswirkungen auf die psychische und gesundheitliche Entwicklung hat, dass die Situation wie in einem Teufelskreis weitere Vulnerabilität und in der Folge soziale und gesellschaftliche Isolation produziert. Basierend auf dem derzeitigen interdisziplinären Forschungsstand möchte ich im folgenden Beitrag soziale Isolation als Verletzung eines biologischen Grundbedürfnisses darstellen und dafür plädieren, dass eine inklusive Pädagogik, die sich im Kern mit Fragen der sozialen Partizipation und der Überwindung behindernder Lebensbedingungen auseinandersetzt, sich dringend des mehrdimensionalen Problemzusammenhangs sozialer Isolation (vgl. Hoffmann & Steffens 2022) annimmt und deren Analyse zur Grundlage ihrer wissenschaftlichen wie praktischen Bemühungen macht.
Psychische Entwicklung: Menschen sind zum sozialen Miteinander geboren
Menschen sind durch und durch soziale Wesen. Das ist keineswegs eine neue Erkenntnis und trotzdem wird häufig noch unterschätzt, wie sehr die biologische Entwicklung des Menschen von der sozialen Umwelt abhängt und wie formgebend soziale Interaktionen für die menschliche Psyche sind. Die hartnäckige Überzeugung, dass die genetische Ausstattung eines Menschen seinen Entwicklungspfad unbeirrbar prägt, muss heute als Fehlkonzept abgetan werden. Führt man sich vor Augen, dass ein Mensch nur über etwa 22.000 Gene verfügt (weniger als Fruchtfliegen) und dazu noch alle Menschen zu 99,9 Prozent das gleiche Genom teilen (Järvilehto & Lickliter 2016), wird schnell deutlich, dass die Komplexität individueller Entwicklung sich nicht allein aus den Genen ergibt. Vielmehr spielt die stark durch Umwelteinflüsse (etwa Nahrung), insbesondere aber auch durch soziale Faktoren wie Stress und Bindung beeinflusste Genaktivierung eine entscheidende Rolle. Gene sind zwar wichtige basale Bausteine, können jedoch nur im epigenetischen Kontext dynamischer Genaktivierung durch Umwelterfahrungen verstanden werden.
Spätestens mit der Geburt sind Neugeborene vollständig in Richtung einer sozialen Gemeinschaft mit anderen Menschen ausgerichtet. Dafür sind sie mit einer ganzen Reihe an biologischen Funktionen ausgestattet, die es ihnen möglich machen, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren. So wenden sie sich vorzugsweise Gesichtern und Stimmen zu und zeigen eine Präferenz für den Klang der Stimmen, die sie bereits im Uterus vernommen haben. Sie suchen von Beginn an aktiv den Kontakt zu anderen Menschen und sind in der Lage, Interaktionen auszulösen und mitzugestalten (vgl. Trevarthen 2012). Im Unterschied zu anderen Säugetieren hängt das Überleben nach der Geburt bei Menschen nicht davon ab, wie schnell sie in der Lage sind, sicher auf ihren Beinen zu stehen oder auf einen Baum zu klettern, sondern wie gut die Interaktionen mit der sozialen Umwelt gelingen und ihre Bedürfnisse erkannt werden. Die Gemeinschaft mit anderen Menschen ist jedoch nicht nur der Schlüssel zum Überleben, sondern für die sich entwickelnde Psyche gleichzeitig das Fenster zur Welt. So ist die „Beziehung zur Außenwelt voll und ganz durch die Beziehung über einen anderen Menschen vermittelt“ (Vygotskij 2003, 147). In der menschlichen Entwicklung lassen sich soziale und biologische Faktoren folglich kaum trennen, vielmehr ist die biologische Entwicklung nur durch und in sozialen Entwicklungssituationen denkbar.
Soziale Biologie: Hirnentwicklung und soziale Interaktionen
Besonders deutlich wird der Einfluss sozialer Umwelten im Bereich der Hirnentwicklung. Soziale Erfahrungen wirken derart strukturierend auf das Organ, dass das Gehirn in der neurowissenschaftlichen Literatur häufig als soziales Organ kategorisiert wird (vgl. Schore 2003). Der häufig bemühte Begriff der Neuroplastizität besagt, dass sich die neurobiologische Struktur des Gehirns in Abhängigkeit von den Lebenserfahrungen eines Menschen formt. „Wie wir heute wissen, modifizieren alle unsere Erfahrungen, Wahrnehmungen und Interaktionen mit der Umwelt zeitlebens die neuronalen Strukturen.“ Diese prinzipielle Formbarkeit des Gehirns durch das, was Menschen erleben, entspricht der erfahrungsabhängigen Dimension neuronaler Entwicklung (vgl. Fuchs 2017, 161). Dabei wirkt die Umwelt nicht unvermittelt auf die sich entwickelnde Psyche, sondern selbstredend über andere Personen der sozialen Entwicklungssituation. Entsprechend sind nicht nur direkte Bezugspersonen, sondern auch pädagogische Einrichtungen und Institutionen und die Beziehung des Kindes zu diesen für die psychische Entwicklung entscheidend. Als methodologische Blaupause dieser Erkenntnis kann bis heute ein Grundgedanke der kulturhistorischen Psychologie gelten: Der Mensch greift im Aufbau der Psyche nicht nur auf eigene individuelle Erfahrungen zurück. Durch die Interaktion mit anderen Menschen stehen ihm auch deren Erfahrungen und darüber hinaus die vergangener Generationen der jeweiligen kulturellen Gemeinschaft zur Verfügung. Die menschliche Psyche entwickelt sich, vermittelt durch andere Menschen, im Kontext der historisch, kulturell und sozial vorhandenen Erfahrungen einer Gemeinschaft. Alle psychischen Funktionen sind zunächst zwischen den Menschen als interpsychische Funktionen vorhanden. In ihrer Entwicklung „wandern“ sie im Menschen als intrapsychische Funktionen nach innen (vgl. Vygotskij 2003). In Anlehnung an die kulturhistorische Neuropsychologie lässt sich für die menschliche Hirnentwicklung formulieren: Wir lernen nicht mit einem Gehirn, sondern in Gesellschaft mit vielen Gehirnen (vgl. Steffens 2019).
Intersubjektivität: Resonanz und Synchronisation
Menschen lernen in Interaktion mit anderen Menschen. Was aber ist die Basis für gelingende Interaktionen und welche Faktoren bestimmen die Interaktionsqualität? Aufgrund der mittlerweile existierenden technischen Möglichkeiten gibt es dazu unterdessen in unterschiedlichen Forschungszweigen aufschlussreiche Ergebnisse. So zeigen Interaktions- und Mikrosequenzanalysen zwischen Kleinkindern und ihren Bezugspersonen intersubjektive Episoden, in denen rhythmische und synchronisierte Verhaltensäußerungen in Mimik, Gestik, Lauten oder Körperbewegungen zwischen den Dialogpartner*innen auftreten. Die feine rhythmische Abstimmung innerhalb dieser lebendigen Interaktionen führte dazu, dass Stephen Malloch und Colwyn Trevarthen sie als „‚musical‘ or ‚dance-like‘“ (Malloch & Trevarthen 2009, 1) charakterisierten. Zwischen Menschen entwickelt sich ein gemeinsamer Rhythmus, der die Struktur einer gemeinsamen Geschichte aufweist und einem geteilten emotionalen Narrativ entspricht (vgl. Trevarthen 2012). Geteilte emotionale Narrative nehmen eine zentrale Rolle für die psychische Entwicklung des Menschen ein, da aus den rhythmisch abgestimmten Interaktionen fortlaufend gemeinsame Bedeutungen hervorgehen (vgl. Stern 2010), die die Basis von Lernprozessen bilden (vgl. Steffens 2019). Aber auch andere Aspekte der psychischen Entwicklung, wie Identität und Selbstkonzepte, entstehen innerhalb der in Synchronisation geteilten emotionalen Narrative (ebd., 2020). Die Erkenntnis, dass Menschen sich in frühkindlichen Interaktionen zueinander wie Tanzpartner*innen verhalten, um ihre gemeinsamen Interaktionen zu koordinieren, hat an Bedeutung noch zugenommen, seit nachweisbar ist, dass daraus auch eine Koordination von inneren emotionalen Zuständen und Erregungsniveaus entsteht (vgl. Schore 2003). Innerhalb synchroner Episoden der Interaktion synchronisieren sich auch Prozesse im Inneren des Körpers. Dies lässt sich nicht nur in frühkindlichen Dialogen belegen, sondern auch zwischen Erwachsenen. Außerdem gibt es mittlerweile deutliche Hinweise, dass es zu Synchronisation von Gehirnen bzw. Hirnwellen bei geteilter Intentionalität, Kooperation und beim gemeinsamen Lernen kommt (vgl. Fishburn et al. 2018). Menschliche Gehirne scheinen wie dafür gemacht zu sein, miteinander zu interagieren, und schwingen sich buchstäblich aufeinander ein. Das Gehirn agiert dabei wie ein Beziehungsorgan und vermittelt ständig zwischen Körper, Geist und Umwelt (vgl. Fuchs 2017). Als grundlegendes Prinzip hinter dieser Form der aufeinander abgestimmten Interaktionen vermutet Fuchs das Prinzip der Resonanz. Entsprechend markiert er den menschlichen Körper als ein schwingungsfähiges Resonanzorgan, das in der Lage ist, sich sensitiv auf die Frequenzen der expressiven Verhaltensäußerungen von anderen Körpern einzuschwingen. „Neuronale Netzwerke repräsentieren nicht Objekte oder Situationen der Außenwelt, sondern sie schwingen koordiniert mit Umweltreizen mit, insofern diese in Entsprechung zu bestimmten, schon vorgebahnten neuronalen Mustern angeordnet sind.“ (Ebd., 185) Erlernte Fähigkeiten sind aus dieser Perspektive keine statischen neuronalen Abbilder, die an einem bestimmten Ort im Gehirn gespeichert werden und die Welt widerspiegeln, sondern in einem gemeinsamen Rhythmus mit den gegebenen Umweltbedingungen schwingende neuronale Aktivitäten (vgl. ebd. 2017). Wenn man sich in einem solchen intersubjektiven Resonanzraum zeitweise auf die Frequenz des Gegenübers einstimmt, entsteht Synchronisation (vgl. Schore 2001). Die menschliche Psyche ist auf diese Weise mit der jeweils intersubjektiven Welt in einem dialektischen Verhältnis elementar verbunden. „Two minds create intersubjectivity. But equally, intersubjectivity shapes the two minds.“ (Stern 2004, 78)
Zugehörigkeit und soziale Gemeinschaft
Ein solches Verständnis von Intersubjektivität, synchronisierten Interaktionen und emotional geteilten Narrativen erlaubt auch eine neue Perspektive auf wichtige Meilensteine der Evolution der spezifisch menschlichen Psyche. So stellt Michael Tomasello heraus, dass die Fähigkeit zur Kooperation den Menschen deswegen so einzigartig macht, weil Menschen in der Lage sind, in geteilter Intentionalität ein „Wirgefühl“ zu entwickeln, das nicht nur die Koordination von gemeinsamen Handlungen und Zielen unterstützt, sondern in sich selbst schon ein Motiv für Kooperation darstellt (Tomasello 2020). Die einzigartige Bedeutung von kultureller und sozialer Gemeinschaft ist das, was den Menschen in seiner Entwicklung ausmacht und von anderen Säugetieren unterscheidet. Nur so lassen sich Forschungen interpretieren, die die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gemeinschaft als ein universelles biologisches Grundbedürfnis bezeichnen. So skizzieren Roy Baumeister und Mark Leary (1995) in einem viel zitierten Artikel entsprechend einen „need to belong“ und begründen dies unter anderem durch die evolutionäre und stammesgeschichtliche Entwicklung der menschlichen Gattung. Nur durch die gelingende Kooperation in sozialen Gruppen war es der Spezies Mensch möglich, widrigen Lebensbedingungen zu trotzen. Ein Ausschluss aus dem sozialen Gruppengefüge dagegen gestaltete sich für Individuen in der Stammesgeschichte des Menschen als unmittelbar lebensgefährlich, da ein Überleben allein kaum möglich war. Aus meiner Sicht sind gelingende Interaktionen und die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gemeinschaft, als Konsequenz der bisher formulierten Zusammenhänge, ein basales Grundbedürfnis und somit auf einer Ebene mit dem Bedürfnis nach Schlaf, Nahrung und Wärme anzusiedeln. Die Annahme erhärtet sich insbesondere dann, wenn man ihre Störung oder Abwesenheit und die damit verbundenen Folgen für die psychische und gesundheitliche Entwicklung zur Kenntnis nimmt.
Soziale Isolation als Deprivation eines biologischen Grundbedürfnisses
In den 1940er-Jahren dokumentierte René Spitz in seinen Untersuchungen zum Hospitalismus-Syndrom in Säuglings- und Waisenheimen, dass Neugeborene und Kleinkinder, die in den Institutionen ohne oder mit nur wenig mütterlichem Kontakt lebten, häufig unter schweren psychischen Störungen litten (vgl. Spitz 1980). Kurz nach der Trennung von den Bezugspersonen kam es zu häufigem und starkem Weinen der Kinder, die zu anderen erwachsenen Personen Kontakt aufzunehmen versuchten, sich verzweifelt an diesen festklammerten und Angst hatten, allein gelassen zu werden. Wenn diese Bemühungen jedoch scheiterten, wurden die Kinder zunehmend apathisch und begannen „mit weit geöffneten, ausdruckslosen Augen dazuliegen oder dazusitzen, mit erstarrtem, unbeweglichem Gesicht und abwesendem Ausdruck, wie in einer Betäubung“ (Spitz 1980, 281). Bei bestehender sozialer Isolation berichtet Spitz von einem zunehmend schweren Zerfall psychischer und körperlicher Funktionen. Neben Nahrungs- und Kontaktverweigerung, Schlaflosigkeit und einer gesteigerten Infektionsanfälligkeit (vgl. ebd., 292) kam es zu psychischen Funktionsstörungen, starkem Gewichtsverlust „und schließlich, wenn der Mangel an affektiver Zufuhr bis ins zweite Lebensjahr hinein andauert, zu einer auffallenden Erhöhung der Sterblichkeitsquote“ (ebd.). Obwohl die Beschreibung und der Begriff des Hospitalismus häufig Spitz zugeschrieben wird, gab es bereits Ende des 19. Jahrhunderts eine rege Debatte über das Phänomen und die Frage, ob Neugeborene und Kleinkinder unter der Obhut und Pflege von Institutionen gedeihen können. Zur damaligen Zeit waren viele Kinderärzte der Ansicht, dass, wenn eine Institution modernen Prinzipien folge, diese genauso in der Lage wäre, den Kindern eine genauso gesunde und entwicklungsfördernde Umwelt zu bieten wie enge Bindungspersonen. Die immens hohe Sterberate in entsprechenden Anstalten lag in Deutschland zu der Zeit teilweise über 70 Prozent (vgl. Rowold 2018, 804). Da man jedoch hauptsächlich hygienische Bedingungen dahinter vermutete, führte dies zu kontraproduktiven Gegenmaßnahmen, wie zusätzlicher Isolation nach außen, um den Kontakt mit Keimen zu verringern (vgl. ebd.). Spitz’ einflussreiche Arbeiten machten deutlich, dass die schweren Entwicklungsregressionen und vielen Todesfälle in direktem Zusammenhang mit einer emotionalen Deprivation der Kinder standen, die aus den fehlenden sozialen Beziehungen in den Institutionen resultierte.
Soziale Isolation und Einsamkeit
Heute zeigen eine Reihe von Langzeitstudien, dass sich soziale Isolation nicht nur negativ auf die psychische Entwicklung von Neugeborenen und Kleinkindern auswirkt, sondern auch auf die Gesundheit von Erwachsenen. Insbesondere bei älteren Menschen, die in Altenheimen, Pflegeeinrichtungen oder zu Hause in soziale Isolation geraten, lässt sich eine erhöhte Sterblichkeitsrate belegen (vgl. Cacioppo et al. 2011). Außerdem verdoppelt sich das Risiko, an Alzheimer zu erkranken (vgl. Wilson et al. 2007). Einige Langzeitstudien, die den schädlichen Einfluss auf Gesundheit und Lebenserwartung dokumentieren, betrachten soziale Isolation aus diesem Grund als ähnlich starken Risikofaktor für die Gesundheit wie Bluthochdruck, Fettleibigkeit und Tabakrauchen (Cacioppo et al. 2011). Auf psychischer Ebene treten neben Depressionen auch andere Reaktionen auf, die mit signifikanten Einschränkungen der kognitiven und exekutiven Funktionen der Betroffenen einhergehen (vgl. Cacioppo & Hawkley 2009). Dies ist insbesondere auch für heranwachsende Kinder und Jugendliche dramatisch (vgl. Almeida et al. 2022). Kurz: Menschen sind für soziale Isolation einfach nicht gemacht.
In der Forschung zur sozialen Isolation wird begrifflich zwischen einer „objektiv-faktischen“ und einer „subjektiv wahrgenommenen“ Isolation (perceived isolation) unterschieden. Letztere wird auch häufig unter dem Begriff „Einsamkeit“ gefasst, der sich insbesondere in der deutschsprachigen Literatur häufig findet. Begründet wird die Unterscheidung hauptsächlich damit, dass man sich einerseits trotz relativ weniger sozialer Kontakte nicht isoliert fühlen muss, sich andererseits aber auch inmitten einer Menschengruppe einsam fühlen kann. Ich halte diese Argumentation, insbesondere aus der Perspektive der Forschung, für problematisch. Einsamkeit ist eher ein literarisches Konzept als eine wissenschaftliche Kategorie. Die Erforschung von „perceived isolation“ stellt sich aus diesem Grund als schwierig heraus, insbesondere dann, wenn es um Personen geht, denen dieses kulturelle Konzept fremd ist. Außerdem können Kinder oder auch Menschen mit sogenannter Behinderung unter sozialer Isolation leiden, ohne dass sie sich als einsam beschreiben würden oder können. Es ist zwar hilfreich, sich in der Forschung auf die Dimension des subjektiven Empfindens sozialer Isolation zu beziehen, aber in der Debatte wird doch schmerzlich deutlich, dass es der Kategorie Einsamkeit an einem theoretischen Unterbau fehlt, wie ihn der Isolationsbegriff der kritisch materialistischen Behindertenpädagogik (vgl. Jantzen 1992, 2020) aufweist. Insgesamt scheint in der derzeitigen Forschung wenig über die psychobiologischen Hintergründe bekannt zu sein, die das Erleben sozialer Isolation zu einem immensen Gesundheitsrisiko werden lassen, sodass hier sicher noch weiterer Bedarf an Forschung und Theoriebildung besteht.
Fehlende und gestörte Antwortverhältnisse
Ein Blick in die Geschichte der Isolationsforschung wäre diesbezüglich sicherlich hilfreich. So beschreibt schon Spitz den zwischenmenschlichen Dialog als wechselseitigen Rückkoppelungsstromkreis, in dem „sich immer neue Konstellationen von zunehmender Komplexität und ständig variierende Energieverschiebungen ergeben“ (Spitz 1988, 67). Mangelnde Rückkoppelungen und Energieverschiebungen dieser Art bringt er mit den Formen sozialer und emotionaler Deprivation in Zusammenhang, unter der hospitalisierte Kinder leiden (Steffens 2020, 134 ff). Bestätigung findet eine solche Annahme durch eine seit Ende der 1970er-Jahre existierende experimentelle Anordnung: den Still-Face-Test (vgl. Tronick 1989), auch Still-Face-Paradigma genannt (vgl. Mesman et al. 2009). Während des Experiments interagieren Mutter und Kind sensitiv aufeinander abgestimmt, lachen gemeinsam und führen kleine Spiele durch. Dann stellt die Mutter zu einem bestimmten Zeitpunkt (zumeist für drei Minuten) ihre sensitiven Reaktionen gegenüber dem Kind gänzlich ein. Ihr Gesichtsausdruck wird regungs- und emotionslos, ein „Still-Face“. Die Kinder reagieren sofort auf diese Veränderung. Zwar versuchen sie zu Beginn noch häufig mit allen ihren dialogischen Fähigkeiten, die Interaktion wieder zu beleben, werden jedoch bei anhaltender Reaktionslosigkeit der Mutter zunehmend frustriert und reagieren letztlich mit Kummer, Not und Stress (vgl. Trevarthen 2012). Nimmt die Mutter den Dialog wieder auf, tröstet sie oder beruhigt das Kind, beginnt die aufeinander abgestimmte Interaktion in den meisten Fällen erneut. Trevarthen konnte im Laufe der Jahre nachweisen, dass die Kinder keinesfalls nur erschrocken auf das ungewohnte Gesicht der Mütter reagierten, sondern dass sich die Reaktion auf das Fehlen der wechselseitig aufeinander abgestimmten (synchronisierten) Interaktion zwischen den Dialogpartner*innen bezog. Dafür konstruierte er unter anderem ein Folgeexperiment, in dem über eine Doppel-Video-Verbindung zwischen Mutter und Kind eine entsprechend über Bildschirme verlaufende, zeitlich abgestimmte Kommunikation ermöglicht wird (vgl. Trevarthen & Aitken 2001). Wird in dieser Verbindung an einer besonders belebten und emotional erregten Stelle die Sequenz aufgenommen und dem Kind in einer Endlosschleife vorgespielt, sind die Reaktionen identisch mit denen des Still-Face-Tests, da auch hier „das Verhalten der Mutter […] im Timing unangemessen ist und nicht genau auf das reagiert, was das Baby gerade macht“ (Trevarthen 2012, 107). Das Still-Face-Paradigma gilt als ein sehr solider Hinweis darauf, dass die Natur gelingender Interaktionen in ihrem rhythmisch aufeinander abgestimmten, wechselseitig synchronen Antwortverhältnis zwischen den Interaktionspartner*innen liegt, und erlaubt darüber hinaus Synthesen mit anderen Forschungsgebieten, die sich mit nicht gelingenden Interaktionen beschäftigen.
Ostracism: Soziale Ablehnung und Ausgrenzung
Ein weiterer Grund, Formen der sozialen Isolation nicht eindimensional auf Einsamkeit zu beziehen, findet sich in den Ergebnissen der Ostracism-Forschung, die misslingende Interaktionen anhand der Dimension fehlender Zugehörigkeit und sozialer Ablehnung untersucht. Der Begriff „Ostracism“ wird dabei auf ein weites Spektrum menschlicher Erfahrungen von Ablehnung und Mobbing bezogen und besonders in der Schule, am Arbeitsplatz und innerhalb persönlicher Beziehungen untersucht. Dabei wurde mit dem sogenannten „Cyberball-Paradigma“ ein experimentelles Format geschaffen (vgl. Williams & Nida 2011), in dem versucht wird, eine Situation herzustellen, in der Personen sich ausgeschlossen oder ignoriert fühlen (vgl. Eisenberger et al., 2003). Während sich die Beteiligten im „Cyberball“ einen Ball zuspielen (ähnlich wie bei einem digitalen Tischtennisspiel), wird ab einem bestimmten Punkt eine Person aus dem Spiel ausgeschlossen und ihr werden keine Bälle mehr zugespielt. Unter Laborbedingungen und durch bildgebende Verfahren der fMRT lässt sich in einer solchen experimentellen Situationen eine deutlich erhöhte Aktivität derjenigen Hirnregionen beobachteten, die üblicherweise bei körperlichen Schmerzen aktiviert werden. Der sogenannte „Overlap“ von psychischen und physischen Schmerzen besteht bis zu 90 Prozent aus übereinstimmender neuronaler Aktivierung und hat zur Begrifflichkeit „sozialer Schmerz“ (social pain) geführt (vgl. Eisenberger 2015). Menschen reagieren mit fast identischen neuronalen Alarmsystemen wie bei körperlichen Schmerzen, wenn sie „außen vor gelassen“, abgelehnt oder ignoriert werden. Schon allein die Sorge, in der nahen Zukunft abgelehnt oder ausgeschlossen zu werden, kann zu einer messbaren Schwächung des Immunsystems führen (vgl. Dickerson et al., 2009). Ohne weiter auf diese Studienlage einzugehen, lässt sich hier doch bereits ein gewisses Muster der menschlichen Reaktionen auf nicht gelingende soziale Interaktionen erkennen, das ich an anderer Stelle bereits grundlegend in den Kontext fehlender emotionaler Resonanz gestellt habe (Steffens 2019).
Ausblick
Eine Auseinandersetzung mit der Bedeutung von sozialen Interaktionen und Resonanzbeziehungen für menschliche Entwicklung lässt aus meiner Sicht nur den Schluss zu, gelingende Antwortverhältnisse als grundlegendes Ziel und gleichzeitig als Bedingung einer inklusiven Pädagogik zu formulieren. Setzt man sich mit fehlenden Resonanzbeziehungen in der Isolations- oder Hospitalismusforschung auseinander, müssen gelingende Interaktionen und Zugehörigkeit als ein biologisches Grundbedürfnis menschlicher Entwicklung definiert werden. Antwortarme Räume oder fehlende dialogische Passung, die Möglichkeiten zur Resonanz, Synchronisation und zu geteilten Rhythmen erschweren, entpuppen sich nicht zufällig häufig als Formen sozialer Ausgrenzung aus menschlicher Gemeinschaft. Forschungen zu Exklusion täten insofern gut daran, Räume der Exklusion auch als schwingungsarme Räume zu untersuchen und die Wirkung von Prozessen sozialer Isolation und gesellschaftlicher Ausgrenzung im Licht eines Bruches der Resonanzbeziehungen in zwischenmenschlichen Begegnungen zu betrachten. Insbesondere auf der Ebene institutionalisierter Beziehungsformen impliziert ein solches Vorgehen nichts anderes als eine tiefgreifende Transformation bestehender Verhältnisse. Für eine inklusive Pädagogik bedeutet ein solcher Transformationsprozess, konsequent soziale Entwicklungssituationen als Resonanzraum in den Blick zu nehmen und Bedingungen zu ermöglichen, die Partizipation und Teilhabe als emotionale Resonanz begreifen und sich an deren gelungener Umsetzung messen lassen.
Literatur
Almeida, I. L. L., Rego, J. F., Teixeira, A. C. G. & Moreira, M. R. (2021): Social isolation and its impact on child and adolescent development: a systematic review. In: Revista paulista de pediatria: orgao oficial da Sociedade de Pediatria de Sao Paulo, 40, e2020385.
Baumeister, R. F. & Leary, M. R. (1995): The need to belong: Desire for interpersonal attach-ments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497–529.
Cacioppo, J. T & Hawkley L. C (2009): Perceived social isolation and cognition. Trends in Cognitive Sciences, 13(10), 447–454.
Cacioppo, J. T., Hawkley L. C., Norman G. J. & Berntson, G. G. (2011): Social isolation. Annals of the New York Academy of Sciences, 1231(1), 17–22.
Dickerson, S. S., Gable, S. L., Irwin, M. R., Aziz, N. & Kemeny, M. E. (2009): Social-evaluative threat and proinflammatory cytokine regulation. An experimental laboratory investigation. In: Psychological science 20(10), 1237–1244.
Eisenberger, N. I., Lieberman, M. D. & Williams, K. D. (2003): Does rejection hurt? An FMRI study of social exclusion. In: Science 302(5643),290–292.
Eisenberger, N. I. (2015): Social pain and the brain. Controversies, questions, and where to go from here. In: Annual Review of Psychology 66, 601–629.
Fishburn F. A., Murty V. P. & Hlutkowsky C. O. (2018): Putting our heads together: interpersonal neural synchronization as a biological mechanism for shared intentionality. In: Social Cognitive and Affective Neuroscience 13(9), 841–849.
Fuchs, T. (2017): Das Gehirn – ein Beziehungsorgan. Eine phänomenologisch-ökologische Konzeption. 5. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer.
Hoffmann, T. & Steffens, J. (2022): Behinderung und Isolation – Traditionslinien, Forschungsstand und aktuelle Perspektiven kulturhistorisch-materialistischer Behindertenpädagogik. In: Zeitschrift für Disability Studies (ZDS) 2/2022.
Jantzen, W. (1992): Allgemeine Behindertenpädagogik. Bd. 1. Sozialwissenschaftliche und psychologische Grundlagen. 2. Aufl. Weinheim: Beltz.
Jantzen, W. (2020): Behindertenpädagogik als synthetische Humanwissenschaft. Sozialwissenschaftliche und methodologische Erkundungen. Gießen: Psychosozial-Verlag
Järvilehto, T. & Lickliter, R. (2016): Behaviour Genetics: A Critical Perspective on the Role of Genes in Behaviour. In: Encyclopedia of Life Sciences. Chichester: John Wiley & Sons, 1–5.
Malloch, S. & Trevarthen, C. (Hrsg.) (2009): Communicative musicality. Exploring the basis of human companionship. Oxford / New York: Oxford University Press.
Mesman, J., van IJzendoorn, M. H.; Bakermans-Kranenburg, M. J. (2009): The many faces of the Still-Face Paradigm: A review and meta-analysis. In: Developmental Review 29(2), 120–162.
Rowold, K. (2018): What Do Babies Need to Thrive? Changing Interpretations of ‚Hospitalism‘ in an International Context, 1900–1945. In: Social History of Medicine 32(4), 799–818.
Schore, A. N. (2001): Effects of a secure attachment relationship on right brain development, affect regulation, and infant mental health. In: Infant Mental Health Journal 22(1–2), 7–66.
Schore, A. N. (2003): Zur Neurobiologie der Bindung zwischen Mutter und Kind. In: Heidi K. (Hrsg.): Handbuch der Kleinkindforschung. 3. Aufl. Bern u. a.: Huber, 49–80.
Spitz, R. A. (1980): Vom Säugling zum Kleinkind. Naturgeschichte der Mutter-Kind-Beziehungen im ersten Lebensjahr. 6. Aufl. Stuttgart: Klett-Cotta.
Spitz, R. A. (1988): Vom Dialog. Studien über den Ursprung der menschlichen Kommunikation und ihrer Rolle in der Persönlichkeitsbildung. Ungekürzte Ausg. München: Dt. Taschenbuch-Verl.
Steffens, J. (2019): Rhythmus, Reziprozität und Resonanz. Zeitprozesse und Energieverschiebungen als Kern intersubjektiver Beziehungen. In: Lanwer, W. & Jantzen, W. (Hrsg.): Jahrbuch der Luria-Gesellschaft. Berlin: Lehmanns Media Verlag.
Steffens, J. (2020): Intersubjektivität, soziale Exklusion und das Problem der Grenze. Zur Dialektik von Individuum und Gesellschaft. Gießen: Psychosozial-Verlag.
Stern, D. N. (2004): The present moment in psychotherapy and everyday life. New York: Norton.
Stern, D. N. (2010): Forms of vitality. Exploring dynamic experience in psychology, the arts, psychotherapy, and development. Oxford / New York: Oxford University Press.
Tomasello, M. (2020): Mensch werden. Eine Theorie der Ontogenese. Berlin: Suhrkamp.
Trevarthen, C. (2012): Intersubjektivität und Kommunikation. In: Braun, O. & Lüdtke, U. (Hrsg.): Sprache und Kommunikation. Bd. 8. Stuttgart: Kohlhammer, 82–160.
Trevarthen, C. & Aitken, K. J. (2001): Infant Intersubjectivity. Research, Theory, and Clinical Applications. In: Journal of Child Psychology and Psychiatry 42(1), 3–48.
Tronick, E. Z. (1989): Emotions and emotional communication in infants. In: American Psychologist 44 (2), 112–119.
Williams, K. D. & Nida, S. A. (2011): Ostracism: Consequences and Coping. Current Directions in Psychological Science, 20(2), 71–75.
Wilson, R. S, Krueger, K.R, Arnold S.E et al. (2007): Loneliness and risk of Alzheimer disease. Archives of General Psychiatry 64(2), 234––240.
Vygotskij, L. S. (2003): Ausgewählte Schriften. Bd. 2. Berlin: Lehmanns Media.
Autor:
Jan Steffens, Dr.
Diplom-Behindertenpädagoge und Leiter des Forschungsprojekts „Inklusion im Resonanzraum Schule (IReS). Schulentwicklung als sozial-emotionales Antwortverhältnis in einer pluralen Gesellschaft“ an der Universität Bremen.

