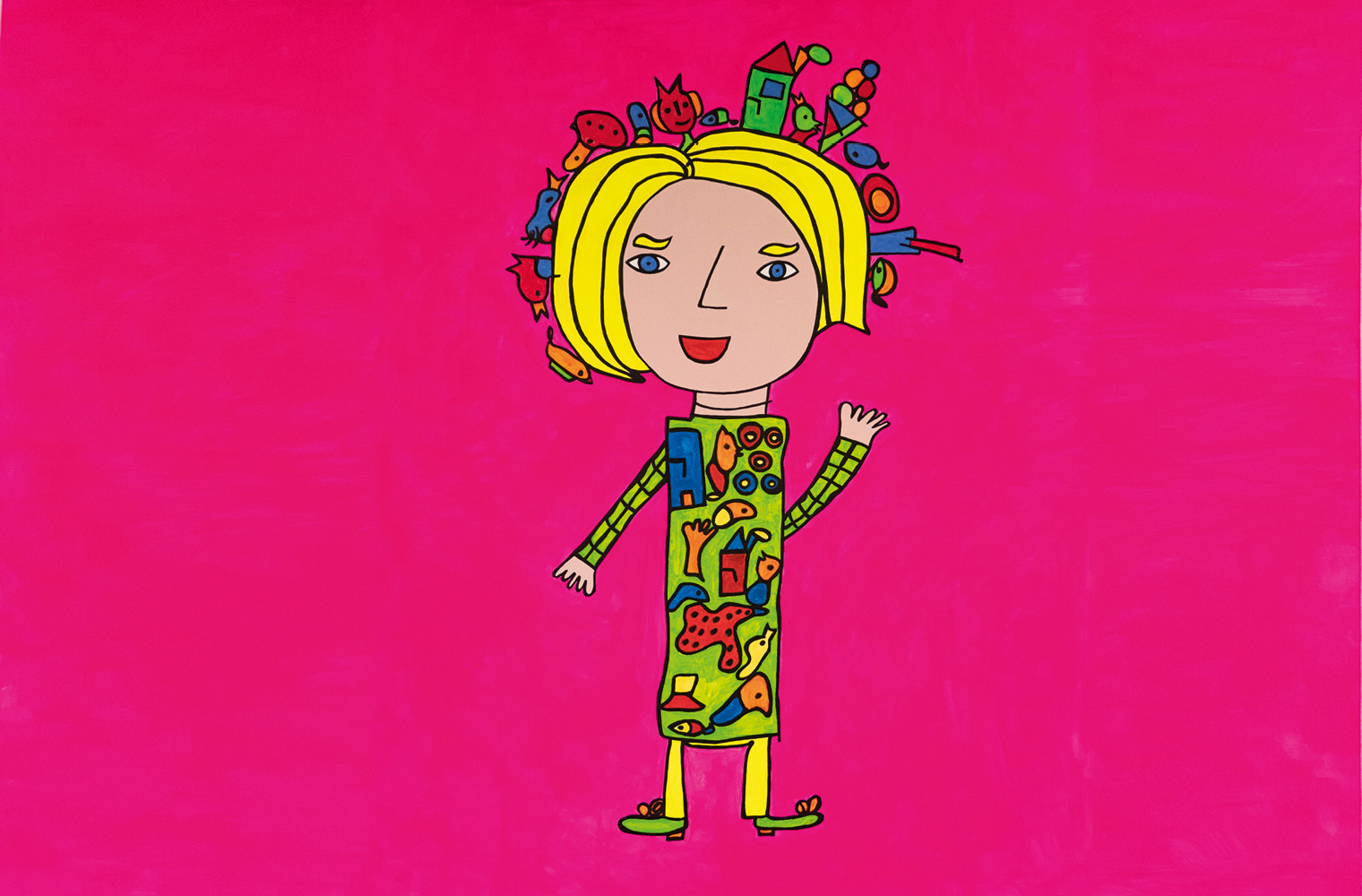
Heike Satter, Lissi, 2019, Acrylstift und Acrylfarbe auf Leinwand, Größe 1,20 × 0,60 m Heike Satter ist Künstlerin des atelierblau, s. Seite 84.
Multiprofessionell, sicher, kompetent - Versorgungsqualität für Menschen mit Behinderung am Lebensende
So unterschiedlich Menschen ihr Leben auch gelebt haben, so ähnlich sind ihre Wünsche für das Lebensende: Die meisten Menschen möchten schmerzfrei oder ohne sonstige belastende Symptome und langes Leiden sterben. Jenseits des Wunsches nach einem schnellen Tod verbinden die meisten Menschen mit einem guten Sterben den Wunsch, umfänglich versorgt, umsorgt und begleitet zu sein.
In diesem Beitrag beschäftigen wir uns mit der Frage, was eine gute Versorgung von Menschen mit geistiger und schwerer Behinderung in der letzten Lebensphase ausmacht. Hierbei verstehen wir unter Versorgungsqualität eine flächendeckende und qualitativ hochwertige Versorgung, welche für die individuellen Versorgungssettings am Lebensende zu definieren ist. Hier gilt als Qualitätskriterium, dass diese konsequent an den Bedarfen und Bedürfnissen des zu versorgenden Menschen ausgerichtet sein muss. Eine gute Versorgung am Lebensende beinhaltet medizinische, pflegerische, psychosoziale und spirituelle Komponenten und bedarf sowohl guter Kooperationsstrukturen der beteiligten Akteure als auch entsprechender Rahmenbedingungen.
Neben der einführenden Auseinandersetzung mit Aspekten einer guten Versorgung am Lebensende werden Ergebnisse des PiCarDi-Projekts zu dieser Dimension präsentiert und aus diesen Empfehlungen für die Versorgungspraxis abgeleitet. Zu grundlegenden Aspekten medizinisch-pflegerischer Versorgung am Lebensende sei auf den Beitrag von Falkson und Tiesmeyer in diesem Heft (siehe Seite 51) verwiesen.
Versorgungsqualität am Lebensende – zum Qualitätsbegriff in der palliativen und hospizlichen Versorgung
„Qualität bezieht sich (…) auf die ,Prozesse‘, die zu den erwünschten Ergebnissen führen. Wenn beispielsweise ein Produkt oder eine Dienstleistung in konsistenter Weise die selbst gesetzten Ansprüche des Produzenten bzw. Dienstleisters trifft, so hat dieses Produkt Qualität – und zwar unabhängig von irgendeinem absoluten Standard“ (Harvey & Green 2000, 18). Hierbei ist Qualität als relativer Begriff zu denken, da er sowohl kontext- als auch personenabhängig in unterschiedlicher Art Verwendung findet.
Speck (2004, 15–30) schlägt eine Differenzierung sozialer Qualität vor, zu der neben der professionellen Qualität auch die organisatorische Qualität gezählt wird. Als lernende Organisationen verbinden diese in qualitätssichernder Weise die Einzelkompetenzen ihrer Mitglieder mit der Institution als Ganzes. Als interaktionale Qualität wird die Kompetenz der Professionellen verstanden, die Begegnung und Beziehung mit ihren Klientinnen und Klienten wertschätzend und respektvoll zu gestalten.
Im Kontext von Versorgung wird Qualität derzeit als gesundheitspolitischer Auftrag vor allem durch die Qualitätssicherung von Leistungsanbietern und ihrer Qualitätstransparenz angestrebt. Die Bestimmungen zur Qualitätssicherung erstrecken sich von der Prävention und Gesundheitsförderung über die Krankenversorgung und die Rehabilitation bis hin zur Pflege und Palliativversorgung (vgl. Gerlinger & Schmucker 2011, 74f.). Ein Weg der Bemühungen um Versorgungsqualität ist ein Wechsel von der Angebots- zur radikalen Betroffenenorientierung, um das Ziel subjektiv gut versorgter Menschen sichern zu können. Im Zusammenhang mit adäquaten Versorgungsstrukturen für Menschen in ihrer letzten Lebensphase stellt dieses Postulat aufgrund der noch nicht gewährleisteten Zugangsmöglichkeiten zu sämtlichen palliativen und hospizlichen Angeboten eine besondere Herausforderung dar. Deshalb muss auf „der Grundlage der bisher bestehenden Gesetzgebung sowie der bisherigen strukturellen Gegebenheiten (…) eine zugangsgerechte und an den Bedarfen der Bevölkerung ausgerichtete, aber gleichfalls gesellschaftlich tragbare Versorgungsentwicklung im gesamten Bundesgebiet zur Erreichung flächendeckender und bedarfsgerechter Gestaltung zukünftiger Palliativversorgung der Bevölkerung im gesamten Bundesgebiet unterstützt werden“ (BAG-SAPV 2015, 9). Diese Bestrebungen um eine den individuellen Bedürfnissen des einzelnen Menschen entsprechende Versorgungsstruktur gelten für alle Menschen – unabhängig von ihren jeweiligen Wohnsettings, familiären Konstellationen oder der Inanspruchnahme spezifischer Sozialleistungen im Kontext von Teilhabe oder Pflege. In der Auseinandersetzung mit spezifischen Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung am Lebensende gilt als Ziel, ihnen „zukünftig sowohl in ihrem gewohnten Lebensumfeld, das sind ggf. auch die Einrichtungen der Eingliederungshilfe, in denen sie seit Jahren leben, als auch in den Einrichtungen des Gesundheitswesens den gleichen Zugang zur hospizlichen Begleitung und palliativen Versorgung zu ermöglichen, der dem nicht behinderter Menschen entspricht“ (Bössing et al. 2018, 67). Somit ist zum einen ein Transfer von Hospizkultur und Palliativkompetenz in das jeweilige häusliche Umfeld und die dortige gesundheitliche Versorgung intendiert. Zum anderen bedeutet dies aber auch die egalitäre Öffnung hospizlicher und palliativer Einrichtungen für Menschen mit Behinderungserfahrungen. Voraussetzung für eine gute Versorgungsqualität am Lebensende ist, dass Menschen mit Behinderung insgesamt einen barrierefreien Zugang zu allen Leistungen der gesundheitlichen Versorgung erhalten und diese in gleicher Qualität nutzen können. Der Einlösung dieses in der UN-Behindertenrechtskonvention (Art. 25) verankerten Rechts stehen im deutschen Gesundheitssystem vielfältige Barrieren gegenüber. Sie sind u.a. darin begründet, dass Leistungsangebote in finanzieller, personeller, räumlicher und sachlicher Hinsicht dem „erhöhten Bedarf an einer individualisierten (auf spezifische Bedarfslagen einer Person abgestimmten) Form der gesundheitlichen Unterstützung nicht gerecht werden“ (Bössing et al. 2018, 76). Umso wichtiger ist es, auch für Menschen mit Behinderung eine adäquate Versorgung am Lebensende sicherzustellen. Da mit steigendem Lebensalter die Multimorbidität sowie der Bedarf an Versorgung durch unterschiedliche Professionen des Gesundheitssystems zunehmen, werden gute Versorgungsstrukturen immer wichtiger und gelten als ein relevanter Bestandteil von Versorgungsqualität (vgl. Borgetto 2011, 302). Dabei bedarf es nicht nur guter Kooperations-, sondern auch ausreichender sowie konstanter Versorgungsstrukturen, die dem Wunsch- und Wahlrecht am Lebensende entsprechen. Besteht dagegen ein Mangel an ambulanten palliativen Strukturen, wird das Sterben zu Hause erschwert (vgl. Müller 2010, 299 in Bezug auf die pädiatrische Palliativversorgung). Dies weist auf die Notwendigkeit der Vernetzung der relevanten Akteure als bedeutsame Qualitätsdimension hin. So wird in der Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen formuliert: „Die Angebote, in denen schwerstkranke und sterbende Menschen versorgt werden, sind untereinander so zu vernetzen, dass die Versorgungskontinuität gewährleistet ist“ (Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen 2016, 19). Ziel ist, dass Haupt- und Ehrenamtliche die An- und Zugehörigen sowie weitere nahestehende Personen des sterbenden Menschen unterstützen und sie auf Wunsch in alle relevanten Themenbereiche einbeziehen. Diese enge Zusammenarbeit kann eine Versorgung im vertrauten bzw. selbst gewählten Umfeld ermöglichen. Der in der Charta definierte Vernetzungsgedanke gilt auch für die allgemeine medizinische Versorgung: „Um eine flächendeckende Begleitung und Versorgung sterbender Menschen zu ermöglichen, bedarf es einer engen Vernetzung zwischen Regelversorgung und spezialisierter Versorgung, insbesondere auch der SAPV“ (ebd., 64). So ist unbestritten, „dass eine Verbesserung der Kooperation der Gesundheitsberufe und der Berufe im Gesundheitswesen überhaupt von zentraler Bedeutung für die Versorgungsqualität ist und angesichts des demografischen und epidemiologischen Wandels auch noch weiter an Bedeutung zunehmen wird“ (Borgetto 2011, 302). Im Kontext einer guten Versorgungsstruktur für Menschen mit Behinderung am Lebensende ist diese Erkenntnis auf die Kooperation mit Fachkräften aus der Behindertenhilfe auszuweiten: „Aus der Schnittstelle zwischen (diesen) Sektoren muss eine Nahtstelle werden, an der Unterstützungsangebote und -formen aus verschiedenen sozialrechtlichen Leistungsbereichen, verschiedenen Versorgungssektoren und die Begleitung durch verschiedene Professionen sinnvoll verknüpft – also „vernäht“ wird“ (Alber et al. 2020, 42).
Eine gute Versorgung am Lebensende ist in ihrer inhaltlichen Ausrichtung entlang der vier Säulen von Palliative Care zu denken, die hier auf die im Projekt PiCarDi generierte Leitlinie zur Versorgungsqualität übertragen wird.
Die vier Säulen von Palliative Care als Basis einer guten Versorgung am Lebensende
Das ganzheitliche Konzept Palliative Care setzt an, wenn eine lebensbedrohende Krankheit nicht mehr geheilt werden kann. Die Aufmerksamkeit der palliativen und hospizlichen Fachkräfte gilt allerdings nicht nur dem Menschen in der letzten Lebensphase, sondern auch seinen An- und Zugehörigen (vgl. Steffen-Bürgi 2017, 42). Die letzte Lebensphase wird dabei nicht ausschließlich auf die letzten Lebenstage eines Menschen reduziert, sondern sie bezeichnet eine Phase, die bereits mit der Diagnosestellung oder während des Krankheitsverlaufs beginnen kann. Das Krankheitsspektrum variiert dabei ebenso wie die Lebensphase, in der sich die Person befindet: Neugeborene, Kinder, Jugendliche und Erwachsene gehören ebenso zum Klientel wie ältere und hochaltrige Menschen.
Im Vordergrund der Bemühungen zur Erreichung der größtmöglichen Lebensqualität dieser Menschen stehen – im Sinne des Total-Pain-Ansatzes (vgl. Saunders et al. 1995) – neben der Kontrolle von Schmerzen und anderen Symptomen vor allem die psychische, soziale und spirituelle Begleitung. Diese tragenden Säulen, in Abbildung 1 als Wurzeln dargestellt, sind die Basis jeder palliativen und hospizlichen Begleitung (vgl. Abb. 1) und werden im Folgenden näher erläutert.
Säule 1: Psychosoziale Begleitung: Die psychosoziale Begleitung umfasst den emotionalen Beistand für Sterbende sowie ihrer An- und Zugehörigen und unterstützt die Beteiligten in der Auseinandersetzung mit dem Sterben und dem bevorstehenden Tod.
Säule 2: Spirituelle Begleitung: Unabhängig von einer konfessionellen oder weltlichen Anschauung beinhaltet die spirituelle Begleitung die Sinnsuche und Transzendenzerfahrung, die Menschen auf ihre eigene Weise bewegen und ausdrücken. Sie umfasst dabei u.a. existenzielle Fragen nach Identität, Sinn, Leid und Schuld sowie wertorientierte und religiöse Überzeugungen (vgl. Kammerer et al. 2013, 141). Die spirituelle Begleitung kann punktuell in akuten Situationen oder fortlaufend in Anspruch genommen werden.
Säule 3: Palliativpflege: Die palliative Pflege umfasst das gesamte pflegerische Handeln sowie spezielle Maßnahmen zum Symptommanagement.
Säule 4: Palliativmedizin: Der wesentliche Bestandteil der Palliativmedizin ist die Linderung der körperlichen Beschwerden. Die Wirkung vieler symptomkontrollierender Medikamente ist bei multimorbiden Personengruppen dabei besonders schwer voraussehbar und möglicherweise mit Nebenwirkungen einhergehend (vgl. Zernikow & Hasan 2013, 162).
Diese vier Säulen und die Berücksichtigung der im Kontext des Projekts PiCarDi generierten Handlungsfelder Bildung – Kommunikation – Organisationsentwicklung und Vernetzung, welche in Abb. 1 als Blätter dargestellt sind, können die flächendeckende und qualitativ hochwertige Versorgung von Menschen am Lebensende maßgeblich beeinflussen.
Ziel von Palliative Care ist es, allen Menschen ein würdevolles Leben und Lebensqualität bis zuletzt zu ermöglichen, wobei die Inanspruchnahme der verschiedenen in den Säulen von Palliative Care abgebildeten Begleitungs- und Versorgungsformen von den individuellen Bedürfnissen und Bedarfen des schwerstkranken Menschen abhängig ist. Fakt ist aber, dass der Ansatz von Palliative Care aufgrund fehlender flächendeckender Versorgungsstrukturen und der oben skizzierten Zugangsbarrieren derzeit nicht allen sterbenden Menschen zugänglich ist. Sollen auch Menschen mit geistiger und schwerer Behinderung ein Lebensende in Würde leben, ist es notwendig, Palliative Care in allen Wohnformen umzusetzen, in denen Menschen in ihrer letzten Lebensphase begleitet werden. Ziel ist, dass Sterbende und ihre Bezugspersonen als eine „unit of care“ einen Platz in der Mitte der Gesellschaft haben. Welche Konsequenzen aus diesen konzeptionellen Forderungen für die Praxis abgeleitet werden können, zeigen die nachfolgenden Erkenntnisse des Forschungsprojektes PiCarDi.
Zentrale Erkenntnisse im Hinblick auf Versorgungsstrukturen am Lebensende
Bildungsangebote für alle Akteure ermöglichen
Im Kontext einer guten Versorgungsstruktur für Menschen mit Behinderung am Lebensende bedarf es Bildungsangebote für alle Beteiligten. Bildung ist hierbei als bewusster, planmäßiger oder informeller Prozess der individuellen Entwicklung zu verstehen, welcher den Zuwachs an objektivem Wissen über Sterben, Tod und Trauer und die Auseinandersetzung mit subjektiven Vorstellungen, Ängsten und Wünschen beinhaltet. Bildungsangebote sind weitgehend von den jeweiligen institutionellen Rahmenbedingungen abhängig und müssen dementsprechend in die Konzeptionen der Organisationen eingebunden sein.
Da Menschen mit geistiger und schwerer Behinderung eine Auseinandersetzung mit Sterben, Tod und Trauer oft nicht zugetraut wird (vgl. Jennessen & Voller 2009, 68f.), ist eine Bewusstseinsschaffung für diese Themen und eine Sensibilisierung für die Relevanz von themenbezogenen Bildungsprozessen als Aspekte lebenslanger Teilhabe und Selbstbestimmung unabdingbar. Menschen mit geistiger und schwerer Behinderung sowie ihre An- und Zugehörigen sollten frühzeitig die Möglichkeit haben, sich mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen, um Entscheidungen in der letzten Lebensphase treffen zu können. Der Austausch mit ihnen über persönliche (Lebens-)Erfahrungen ist notwendig, um eine bedürfnisorientierte Versorgung planen zu können.
Haupt- und Ehrenamtliche palliativer und hospizlicher Einrichtungen sowie von Einrichtungen der Eingliederungshilfe sollten spezifische Bildungsangebote mit dem Ziel einer adäquaten Versorgung von Menschen mit geistiger und schwerer Behinderung nutzen können, die u.a. die Gestaltung von Netzwerken, Besonderheiten der Kommunikation, des sozialen Umfeldes sowie des Symptommanagements, der Spiritualität und ethische Fragestellungen thematisieren (vgl. Jennessen et al. 2020). Auch inklusive Fachtagungen und die Verankerung von Palliative Care in den Curricula verschiedener Ausbildungsgänge können einen zielführenden Austausch und die Weiterentwicklung der palliativen und hospizlichen Versorgung unterstützen.
Individuelle Kommunikations- und Ausdrucksformen bei der Begleitung berücksichtigen
Kommunikation ist eine zentrale Bedingung, damit Menschen mit geistiger Behinderung ihre Bedürfnisse und Wünsche für das Lebensende mitteilen können und somit eine bedarfsgerechte und individuell abgestimmte Versorgung gewährleistet werden kann. Mitarbeiter der Eingliederungshilfe sollten unterschiedliche Kommunikations- und Ausdruckformen kennen und diese in der letzten Lebensphase einsetzen. Aufgrund der Erfahrungen der palliativen und hospizlichen Fachkräfte mit basalen und körpernahen Kommunikationsformen, auf die viele Menschen in ihrer letzten Lebensphase angewiesen sind, kann hier von einem grundsätzlich breiten Erfahrungswissen ausgegangen werden, das es um spezifische Kommunikationsformen zu ergänzen gilt.
Zudem verfügen An- und Zugehörige wie auch Mitbewohner aufgrund der oft langen Beziehungserfahrungen über unverzichtbares Wissen, das in den Begleitprozess einfließen sollte. Dies kann dazu beitragen, unangemessene Versorgungsformen zu vermeiden.
Bedürfnisorientierte Möglichkeiten der Versorgung am Lebensende
Um eine adäquate Versorgung am Lebensende in verschiedenen Wohnformen der Eingliederungshilfe zu gewährleisten, bedarf es themenspezifischer Prozesse der Organisationsentwicklung. Ziel dieser Prozesse ist die Etablierung einer Palliative-Care-Kultur als Bestandteil der allgemeinen Organisationskultur. Diese impliziert die Entwicklung hospizlicher Haltungen, unterstützender Strukturen und Rahmenbedingungen sowie die Verankerung von Palliative Care in den Konzepten der Einrichtung. Eine gute Begleitung am Lebensende kann nur gelingen, wenn die Mitarbeitenden der Wohneinrichtungen diese als ihre Aufgabe begreifen und ein ausreichendes Maß an Handlungssicherheit entwickeln, dieser Aufgabe gerecht zu werden. Für eine gute Versorgung ist es zudem hilfreich, wenn die Bewohner und Fachkräfte in dieser herausfordernden Lebenssituation auf stabile und vertrauensvolle Beziehungen zurückgreifen können. Dies setzt geringe Fluktuationen des Personals voraus, welche vorrangig durch gute Arbeitsbedingungen gewährleistet werden. Zudem ist es hilfreich, den Verbleib in der Wohneinrichtung bis zum Lebensende als Option mit den Bewohnerinnen, Bewohnern und Mitarbeitenden frühzeitig zu kommunizieren. Dies schafft Sicherheit aufseiten der Bewohner und ermöglicht es den Fachkräften, die Begleitung am Lebensende als obligatorischen Bestandteil ihres professionellen Auftrags zu begreifen.
Auch die Möglichkeit, in einem Hospiz oder auf einer Palliativstation zu sterben, steht Menschen mit geistiger und schwerer Behinderung, wie allen schwerkranken Menschen, grundsätzlich offen. Träger und Mitarbeitende dieser Einrichtungen sorgen durch Transparenz, Information und Barrierearmut für Zugangsmöglichkeiten und stellen innerhalb ihrer ambulanten und stationären Kontexte eine adäquate Versorgung sicher. In stationären Settings berücksichtigen sie bedürfnisorientiert die den Klienten aus ihren früheren Wohnsettings vertrauten Tagesstrukturen und Rituale und setzen zugleich Impulse für neue Alltagserfahrungen, die der veränderten Lebenssituation entsprechen.
Interdisziplinarität stärken und feste Kooperationsstrukturen etablieren
Um eine adäquate Versorgung am Lebensende zu gewährleisten, bedarf es über die organisationsinternen Vernetzungen hinaus auch sektorenübergreifender Versorgungsstrategien. So ist es hilfreich, wenn Mitarbeitende der Eingliederungshilfe und palliative und hospizliche Fachkräfte gemeinsame Versorgungsnetzwerke nutzen und miteinander Reflexionsräume schaffen. Auch Einrichtungen in ländlichen Regionen benötigen einen Zugang zu palliativen und hospizlichen Kooperationspartnern. Arbeitskreise mit Menschen mit Behinderung als Experten in eigener Sache können zudem für inhaltliche Abstimmungen und hilfreiche Informationen sorgen. Da die ehrenamtlichen Begleiterinnen im Hospizbereich häufig enge Bindungen zu den schwer kranken Personen aufbauen, ist es wichtig, dass diese im kontinuierlichen Austausch mit den Fachkräften stehen, sodass sich die verschiedenen Perspektiven zu einer ganzheitlichen zusammenführen lassen. Zudem sollten die allgemeinen Versorgungsnetze, zu denen beispielsweise die hausärztliche Versorgung zählt, in die Sterbebegleitung einbezogen werden. Ein im Hinblick auf das Lebensende gestricktes Sorgenetz benötigt sowohl die für diese Lebensphase spezialisierten Fachkräfte als auch die Erfahrungsexpertise langjähriger Begleiter.
Fazit
Die Erwartung, am Lebensende gut versorgt zu sein, beinhaltet für alle Menschen eine große Herausforderung. Zu individuell und letztlich unplanbar stellen sich Lebenssituationen dar, wenn Menschen unheilbar erkranken, aufgrund einer plötzlichen Erkrankung kurzfristig palliativ behandelt werden müssen oder ein schleichender Altersprozess auf das Lebensende hindeutet. Auch eine vorausschauende und enttabuisierte Planung kann den spezifischen Care-Erfordernissen aufgrund der Einzigartigkeit der jeweiligen Situation in der Regel nur begrenzt entsprechen. Dennoch können Bedingungen geschaffen werden, die die Situation rahmen und von den individuellen Bedarfen und Bedürfnissen des Jetzt gestaltet werden. Zu diesen gehören die Sicherstellung des egalitären Zugangs zu allgemeinen und spezialisierten Versorgungsstrukturen, eine etablierte Vernetzung der Akteure der verschiedenen Care-Bereiche und die Etablierung des Themas Palliative Care für Menschen mit Behinderung sowohl in den (Aus-)Bildungsstrukturen der pädagogisch-sozialen als auch der medizinisch-pflegerischen Berufsgruppen. Auf der der Institutionsebene gehören die Etablierung einer Palliative-Care-Kultur in den Einrichtungen der Behindertenhilfe ebenso zu den tragenden Entwicklungsmaßnahmen wie die Kompetenzentwicklung der handelnden Menschen für die Begleitung des Personenkreises. Und auch auf der individuellen Ebene des sterbenden Menschen und seiner An- und Zugehörigen ist die Auseinandersetzung mit Fragen des Lebensendes sowie mit Trauer- und Verlusterfahrungen ein wichtiger Teil der eigenen Identitätsentwicklung, der am Lebensende eine bedürfnisorientierte Versorgung prägen kann.
Literatur
Alber, L., Brocke, F., Jennessen, S., Levin, C., Schäper, S. & Werschnitzke, K. (2020): Von der Schnittstelle zur Nahtstelle – Netzwerke von Eingliederungshilfe und Palliative Care in der Begleitung von Menschen mit geistiger und schwerer Behinderung am Lebensende. In: Hospiz-Zeitschrift, 2, 38–42.
BAG-SAPV (Bundesarbeitsgemeinschaft SAPV) (2015): Stellungnahme der BAG-SAPV zum Gesetzentwurf der Bundesregierung – Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland (Hospiz- und Palliativgesetz HPG). Drucksache 18/5170 vom 12.06.2015.
Borgetto, B. (2011): Soziologische Grundlagen der Versorgungsforschung. In: Schott, T. & Hornberg, C. (Hrsg.): Die Gesellschaft und ihre Gesundheit. 20 Jahre Public Health in Deutschland: Bilanz und Ausblick einer Wissenschaft. Wiesbaden: Springer VS, 293–307.
Bössing, C., Schrooten, K. & Tiesmeyer, K. (2018): Barrieren in der gesundheitlichen Versorgung von Menschen mit Lernschwierigkeiten. In: Walther, K. & Römisch, K. (Hrsg.): Gesundheit inklusive. Gesundheitsförderung in der Behindertenarbeit. Wiesbaden: Springer VS, 51–87.
Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen (2016): Handlungsempfehlungen im Rahmen einer Nationalen Strategie. Berlin. Online verfügbar unter: https://www.charta-zur-betreuung-sterbender.de.
Gerlinger, T. & Schmucker, R. (2011): 20 Jahre Public Health – 20 Jahre Politik für eine gesunde Gesellschaft? In: Schott, T. & Hornberg, C. (Hrsg.): Die Gesellschaft und ihre Gesundheit. 20 Jahre Public Health in Deutschland: Bilanz und Ausblick einer Wissenschaft. Wiesbaden: Springer VS, 69–83.
Harvey, L. & Green, D. (2000): Qualität definieren. Fünf unterschiedliche Ansätze. In: Helmke, A., Hornstein, W. & Terhart, E. (Hrsg.): Qualität und Qualitätssicherung im Bildungsbereich. Weinheim: Beltz, 17–39.
Jennessen, S., Alber, L. & Fellbaum, K. (2020): „Ich glaube schon, dass es wichtig ist, den Betroffenen in irgendeiner Form eine Stimme zu geben.“ Teilhabe und Selbstbestimmung bei Menschen mit geistiger und schwerer Behinderung am Lebensende. In: Teilhabe, 4, 140–146.
Jennessen, S. & Voller, W. (2009): Sterbebegleitung in Wohneinrichtungen für Menschen mit einer geistigen Behinderung. In: Empirische Sonderpädagogik 1, 1, 62–79.
Kammerer, T., Roser, T. & Frick, E. (2013): Spiritualität und Religion. In: Michalsen, A. & Hartog, C. S. (Hrsg.): End-of-Life Care in der Intensivmedizin. Berlin & Heidelberg: Springer, 139–145.
Müller, B. (2010): Pädiatrische Palliative Care. In: Kränzle, S., Schmid, U. & Seeger, C. (Hrsg.). Palliative Care (3. Auflage). Heidelberg: Springer Medizin, 297–307.
Saunders, C., Baines, M. & Dunlop, R. (1995): Living with Dying: A Guide to Palliative Care (3. Auflage). New York: Oxford University Press.
Speck, O. (2004): Marktgesteuerte Qualität – eine neue Sozialphilosophie? In: Peterander, F. & Speck, O. (Hrsg.): Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen (2. Auflage). München: Ernst Reinhardt, 15–30.
Steffen-Bürgi, B. (2017): Reflexionen zu ausgewählten Definitionen von Palliative Care. In: Steffen-Bürgi, B., Schärer-Santschi, E., Staudacher, D. & Monteverde, S. (Hrsg.): Lehrbuch Palliative Care (3. Auflage). Bern: Hogrefe, 40–49.
Zernikow, B. & Hasan, C. (2013): Palliativversorgung von Kindern und Jugendlichen. In: Zeitschrift für Palliativmedizin, 4, 157–172.
Autor:innen
Kristin Fellbaum, M.A.
Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Rehabilitationswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin, Abteilung: Pädagogik bei Beeinträchtigung der körperlich-motorischen Entwicklung, wissenschaftliche Mitarbeiterin des PiCarDi-Projekts und Koordinatorin des FamPalliNeeds-Projekts. Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Palliative Versorgung und hospizliche Begleitung von Menschen mit geistiger und schwerer Behinderung
kristin.fellbaum@hu-berlin.de
Sven Jennessen, Prof. Dr.
Er ist Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Rehabilitationswissenschaften, Abteilung: Pädagogik bei Beeinträchtigung der körperlich-motorischen Entwicklung. Leiter der Projekte PiCarDi, FamPalliNeeds und PraeKids. Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Palliative Care für Menschen mit Behinderung, Kinder- und Jugendhospizarbeit, sexuelle Selbstbestimmung und Behinderung, Inklusive Schulentwicklung.
sven.jennessen@hu-berlin
Judith Lilly Alber, M.A.
Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Rehabilitationswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin, Abteilung: Pädagogik bei Beeinträchtigung der körperlich-motorischen Entwicklung, wissenschaftliche Mitarbeiterin des PiCarDi-Projekts. Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Palliative Versorgung und hospizliche Begleitung von Menschen mit geistiger und schwerer Behinderung
judith.lilly.alber@hu-berlin.de

