Sie wollen weiterlesen?
Dann Ausgabe bestellen und den ganzen Heftinhalt genießen …
… oder jetzt gleich für das Online-Abo entscheiden und vollen Zugriff auf mehr als 1000 Artikel der Zeitschrift Menschen. erhalten.
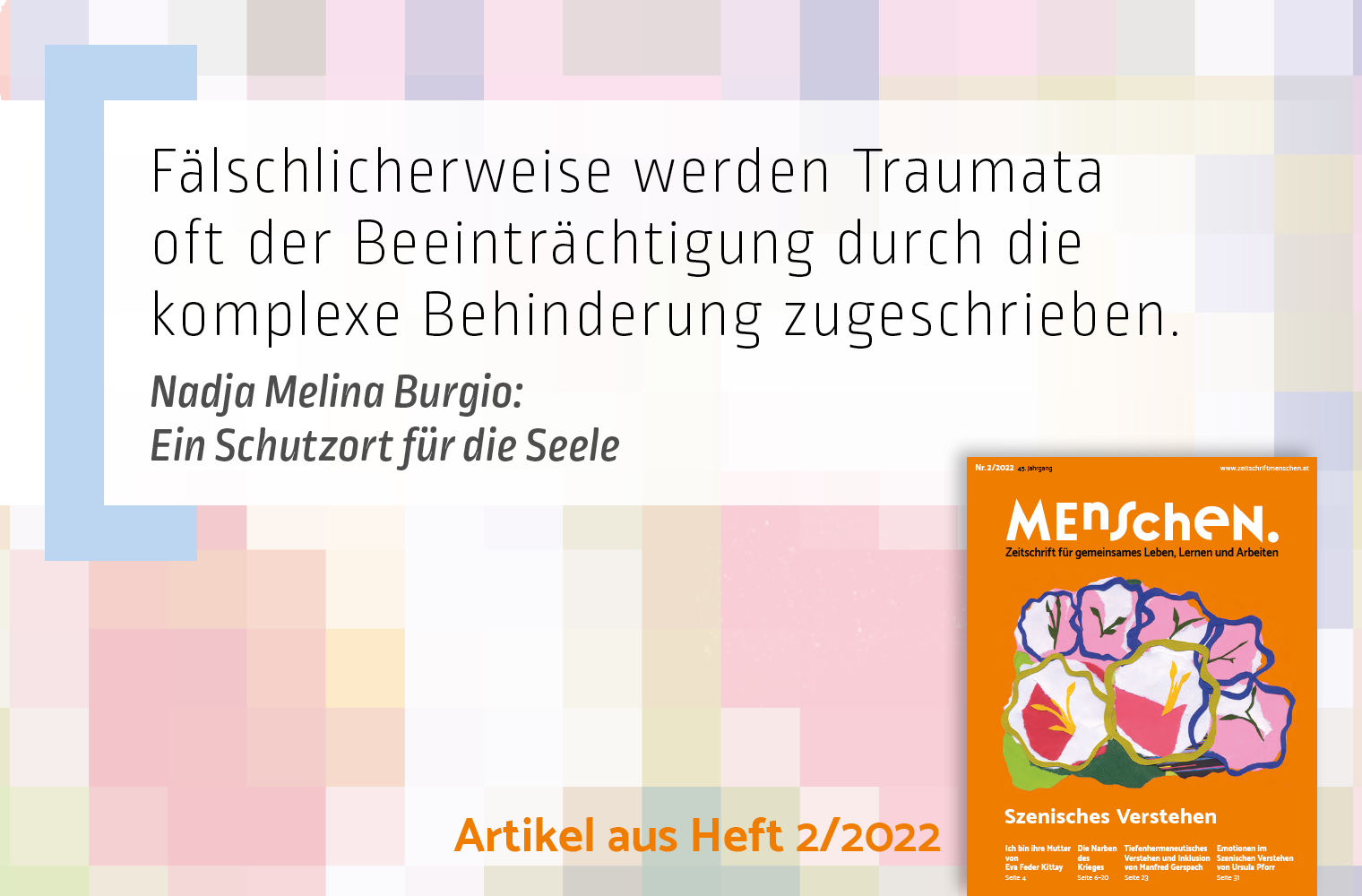
Ein Schutzort für die Seele
Traumata bei Menschen mit komplexer Behinderung
Wenn Menschen mit komplexer Behinderung traumatischen Ereignissen ausgesetzt sind, verlieren sie den Halt und die Stabilität im Leben. Umso wichtiger ist es, ihnen Schutz und Geborgenheit in einer für sie gefahrenvollen Welt zurückzugeben – sie brauchen einen Schutzort für ihre Seele.
Eine Person erlebt bei einer psychischen Traumatisierung eine Diskrepanz zwischen der als bedrohlich wahrgenommenen Situation und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten. Die Betroffenen fühlen sich hilflos und schutzlos ausgeliefert. Sie sind in ihrem Selbst- und Weltverständnis erschüttert (Eichenberg & Zimmermann 2017, 13; Fischer & Riedesser 2020, 88). Das Trauma liegt also nicht in dem Ereignis selbst, sondern in der Reaktion des Menschen.
Auffälliges Verhalten, Auto- und Fremdaggression von Menschen mit komplexer Behinderung können oftmals ein Zeichen von erlebten (und sich wiederholenden) Traumata sein. Teilweise werden sie allerdings fälschlicherweise der Beeinträchtigung durch die komplexe Behinderung zugeschrieben und nicht der eigentlichen traumatischen, teils noch bestehenden existenziell bedrohlichen Situation (Mayer 2018, 97) und der daraus resultierenden Abwehrstrategien (Kühn 2013, 24). Dieses „Diagnostic Overshadowing“ (Jones, Howard & Thornicroft 2008) verhindert, dass die betroffenen Personen entsprechende Unterstützungsangebote in Einrichtungen erhalten (Mayer 2018, 101). Die Folge sind Symptomverschärfungen und wachsende Überlastungen aufseiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Kühn 2013, 24), die sich wiederum auf die Betroffenen auswirken.
Nach Hennicke (2012) ist das Risiko, einer traumatisierenden Lebenserfahrung ausgesetzt zu werden, bei Menschen mit komplexer Behinderung sehr hoch. Dabei handelt es sich eher um Polytraumata – um mehrere Ereignisse oder Bedingungen, die sequenziell oder kumulativ auftreten. Das können zum Beispiel längere Krankenhausaufenthalte sein, vor allem aber, wenn es Betroffenen aufgrund ihrer Beeinträchtigungen im Bereich Sprache und Kommunikation nicht möglich ist, über Belastungen oder Gefahren zu sprechen. Bedeutsam ist hierbei, dass für außenstehende Personen die Ereignisse teils minimal erscheinen, für die Betroffenen aber massiv sind. Diese seelischen Verletzungen schleichen sich langsam und vor allem stetig ein (Hennicke 2012, 8). Für Menschen mit komplexer Behinderung, die die Welt als Bedrohung erlebt haben, gilt es also, einen sicheren Ort zu errichten.
Sicherer Ort
Für die Herstellung eines inneren Sicherheitsgefühls braucht es zunächst auch einen äußeren Ort der Sicherheit. Damit geht einher, dass Fachkräfte fortwährend reflektieren, wie sicher die Einrichtung als Ort und die damit verbundenen Angebote für die Betroffenen sind (Kühn 2013, 33). Dazu gehört das Wissen der Fachkräfte um Traumata und die Folgen – vor allem im alltäglichen Leben. Dies scheint bis dato nicht ausreichend präsent, fehlt teilweise in den Betreuungskonzepten (Rießbeck & Rießbeck 2018, 224) und spiegelt sich in der fehlenden Expertise der pädagogischen sowie therapeutischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort wider. Sie erkennen die Traumafolgespuren bei Menschen mit komplexer Behinderung oftmals nicht und es mangelt an den notwendigen Maßnahmen. Um entsprechende Unterstützungsangebote zu generieren, ist bei den Fachkräften die Entwicklung einer gewissen Traumasensibilität gegenüber den Betroffenen ein erster wichtiger Schritt. Diese beinhaltet Kenntnisse über die Häufigkeit von Traumata bei Menschen mit komplexen Behinderungen, eine Vertrautheit mit deren Alltagswelt, ein Verständnis über (verdeckte) Symptomatiken, ein Wissen über komplexe Entwicklungsproblematiken und deren zahlreiche beteiligte Akteurinnen und Akteure sowie die Reflexion der eigenen Ängste bezüglich der Thematik (Rießbeck & Rießbeck 2018, 224). Gerade der letztgenannte Aspekt ist mit entscheidend für die Schaffung von sicheren Orten. Fachkräfte benötigen selbst eine erlebte institutionelle und persönliche Sicherheit, sowohl auf atmosphärischer als auch auf institutioneller Ebene. Dazu zählen beispielsweise offene Kommunikation, Wertschätzung und eine stabile Leitungspräsenz (Rheinische Gesellschaft für Innere Mission und Hilfswerk 2005; Schmid 2013). Nur unter solchen Voraussetzungen ist die Schaffung von Schutzräumen und damit die Erfüllung des Sicherheitsauftrages für traumatisierte Menschen mit komplexer Behinderung möglich (Schwerwath & Friedrich 2020, 75).
Als weiterer wichtiger Aspekt auf der Ebene der Betroffenen gilt die Erlangung des Gefühls der Sicherheit. Den Menschen muss die Möglichkeit der Kontrolle und Einschätzbarkeit von Situationen zurückgegeben werden, die sie bei den traumatischen Ereignissen verloren haben. Dafür ist unter anderem eine strukturelle Klarheit im pädagogischen Alltag und der Angebotsstruktur notwendig. Dies beinhaltet beispielsweise die Einhaltung von Absprachen, Verbindlichkeit und Transparenz (Schwerwath & Friedrich 2020, 75–77). Des Weiteren ist es in der pädagogischen Arbeit wichtig zu eruieren, welche Anforderungen und Zumutungen als Trigger stressauslösender Situationen dienen und die Betroffenen erneut in ein Ohnmachts- und Diskrepanzerleben führen (ebd., 77). Dies kann bei traumatisierten Menschen bereits bei sehr geringen Reizen der Fall sein. Nach van der Kolk (2021) benötigt der Stresshormonspiegel bei Betroffenen länger, bis er sich wieder auf Normalwerte einpegelt. Damit haben traumatisierte Menschen über längere Zeit ein erhöhtes Stressempfinden. Diese dauerhafte Reaktion kann die Ursache von chronischen Gesundheitsproblemen, aber auch von zunehmenden Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsstörungen, Reizbarkeit sowie Schlafstörungen sein (Kolk 2021, 61). Ein stressverursachender Trigger ist auch der Verlust der Selbstkontrolle. Deshalb ist es umso wichtiger, Betroffenen vermehrt Erfahrungen der Selbstwirksamkeit zu ermöglichen. Dies kann zum einen die Ablehnung von Unterstützungsmaßnahmen durch die traumatisierten Menschen selbst beinhalten (Mattke 2013, 83), die die pädagogischen Fachkräfte akzeptieren müssen. Zum anderen schließt sich daran eine notwendige individualisierte Regelgestaltung an, denn gerade traumatisierte Menschen haben aufgrund der Schwierigkeiten mit der Selbststeuerung allgemein gesetzte Regeln einzuhalten (Schmid & Lang 2013, 280).
Sichere Bezugsperson
Es braucht ebenso eine sichere Bezugsperson, eine Funktion, die durch die pädagogische Fachkraft eingenommen werden kann und teilweise muss. Gerade aufgrund der Tatsache, dass Menschen mit komplexer Behinderung auch häufig unter Entwicklungstraumata leiden (Rießbeck & Rießbeck 2018, 228), ist es wichtig, positive Bindungserfahrungen zu ermöglichen, die das Fundament der Integration des Traumas in das eigene Leben sind. Genau deshalb ist es so bedeutsam, Fachkräfte in ihrer pädagogischen Arbeit mit Menschen mit komplexer Behinderung eine entsprechende Expertise im Umgang mit traumatischen Erlebnissen zu vermitteln.
Eine achtsame Haltung und genaue Beobachtungsgabe von Fachkräften ist in der Arbeit mit Menschen mit komplexer Behinderung, die möglicherweise unter Traumafolgen leiden, vonnöten. Es geht um die Sorge und Verantwortung für Menschen, die möglicherweise nicht in der Lage sind, von Geschehenem zu erzählen und die die Welt als unsicheren Ort erlebt haben bzw. teilweise noch erleben. Vor allem muss sich dieses Wissen auch im professionellen Handeln wiederfinden. Fachkräfte stehen in der Verantwortung, genau hinzusehen, wachsam und achtsam zu sein.
Literatur
Eichenberg, C., Zimmermann, P. (2017): Einführung Psychotraumatologie. München: Ernst Reinhardt Verlag.
Fischer, G., Riedesser, P. (2020): Lehrbuch derPsychotraumatologie, 5. aktualisierte und erweiterte Auflage. München: Ernst Reinhardt Verlag.
Hennicke, K. (Hrsg.) (2012): Traumatherapie bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung. Marburg: Lebenshilfe-Verlag.
Jones, S., Howard, L., Thornicroft, G. (2008): Diagnostic overshadowing: worse physical health care for people with mental illness. In: Acta Psychiatrica Scandinavica, 118 (3), 169–171.
Konig, L. N. (2018): Traumapädagogik mittels TEACCH als Chance für traumatisierte Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung. Ein Praxisbeispiel. In: Kindesmisshandlung und -vernachlässigung, 21 (1), 58–69.
Kühn, M. (2013): „Macht Eure Welt endlich wieder mit zu meiner!“ Anmerkungen zum Begriff der Traumapädagogik. In: Bausum, J., Besser, L., Kühn, M., Weiß, W. (Hrsg.): Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis, 3. Auflage. Weinheim: Juventa, 24–37.
Levine, P. A. (2011): Sprache ohne Worte: Wie unser Körper Trauma verarbeitet und uns in die innere Balance zurückführt. München: Kösel Verlag.
Mattke, U. (2013): Sexuelle Gewalt und Traumatisierung. Pädagogisch-therapeutische Unterstützung von Mädchen und Frauen mit geistiger Behinderung. In: Teilhabe, 52 (2), 80–88.
Mayer, B. (2018): Trauma-Pädagogik im Kontext geistiger Behinderung. In: Schäfer, H., Mohr, L.: Psychische Störungen im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Grundlagen und Handlungsoptionen in Schule und Unterricht. Bad Langensalza: Beltz, 97–108.
Rheinische Gesellschaft für Innere Mission und Hilfswerk GmbH (2005): Ein Sicherer Ort – für Leitungen, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für junge Menschen. Unter: https://manualzz.com/doc/4671244/brosch%C3%BCre--ein-sicherer-ort-. Abgerufen am 22.01.2022.
Rießbeck, H., Müller, G. (Hrsg.) (2019): Traumakonfrontation – Traumaintegration. Therapiemethoden im Vergleich. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
Rießbeck, H., Rießbeck, K. (2018): Trauma und Behinderung. In: Schellong, J., Epple F., Weidner, K.: Praxisbuch Psychotraumatologie. Stuttgart: Thieme, 224–230.
Scherwath, C., Friedrich, S. (2020): Soziale und pädagogische Arbeit bei Traumatisierung, 4. aktualisierte Auflage. München: Ernst Reinhardt Verlag.
Schmid, M. (2013): Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen in der stationären Jugendhilfe: „Traumasensibilität“ und „Traumapädagogik“. In: Fegert, J., Ziegenhain, U., Goldbeck, L. (Hrsg.): Traumatisierte Kinder und Jugendliche in Deutschland, 2. Auflage. Weinheim: Beltz Juventa, 301–311.
Schmid, M., Lang, B. (2013): Überlegungen zum traumapädagogischen Umgang mit Regeln. In: Lang, B., Schirmer, C., Lang, T., Andreae de Hair, I., Wahle, T., Weiß, W., Schmid, H. (Hrsg.): Traumapädagogische Standards in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Eine Praxisorientierung der BAG Traumapädagogik. Weinheim: Beltz Juventa, 280–308.
Van der Kolk, B. (2021): Verkörperter Schrecken. Traumaspuren in Gehirn, Geist und Körper und wie man sie heilen kann. Lichtenau: G.P. Probst Verlag.
Autorin:
Dr. Nadja Melina Burgio ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Pädagogik bei Beeinträchtigungen der körperlich-motorischen Entwicklung am Institut für Rehabilitationswissenschaften der Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftlichen Fakultät an der Humboldt-Universität zu Berlin.
nadja.burgio@hu-berlin.de


