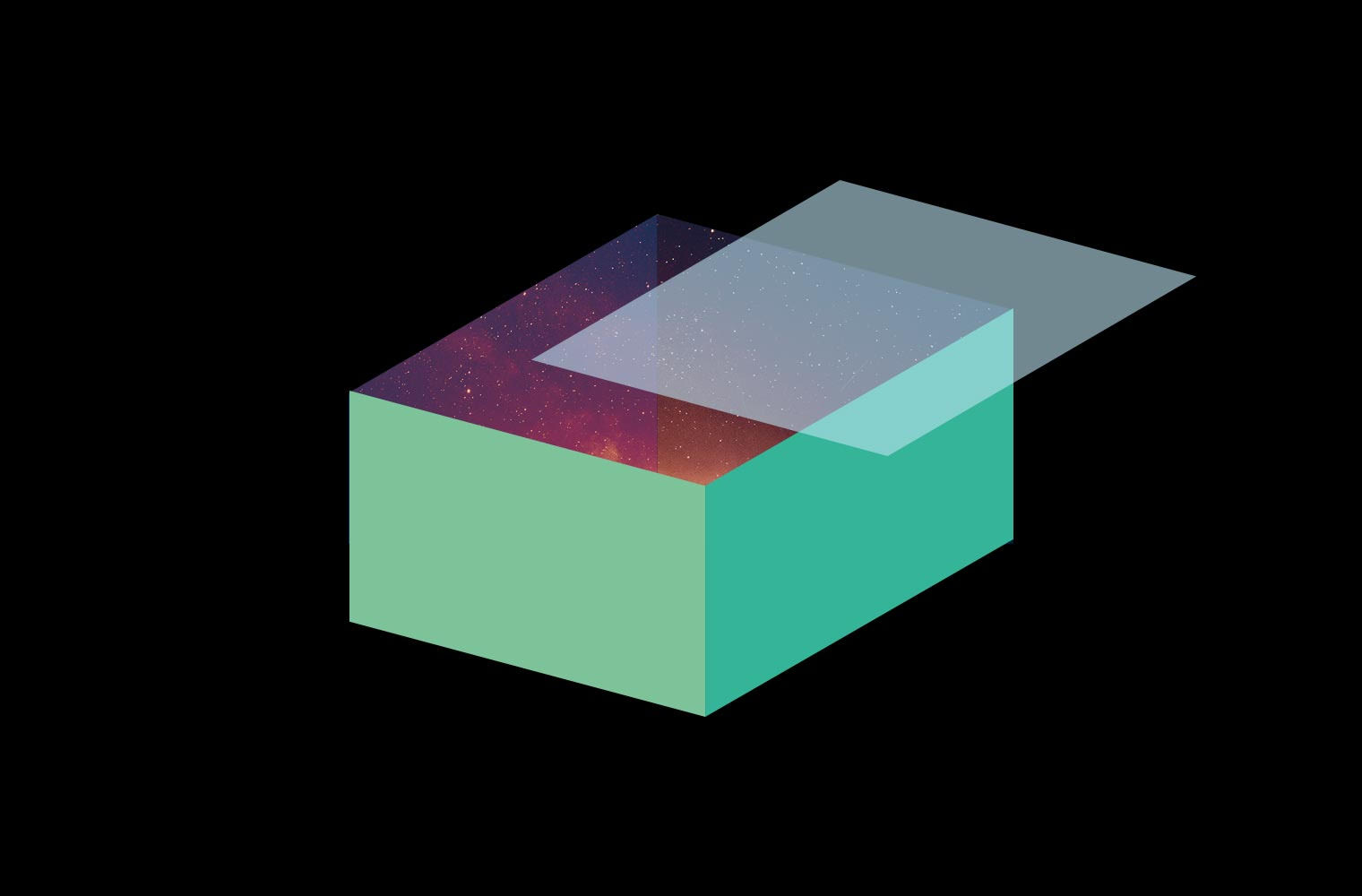
Eine Sechsjährige mit Behinderung erfährt die Welt durch Berührungen – die strengen Corona-Maßnahmen isolieren sie von ihrer Familie.
Lisa Marias Lockdown
Sie hat noch nie in ihrem Leben einen Schluck getrunken, noch nie einen Bissen gegessen. Ernährt wird sie über einen Plastikschlauch, der in den Magen führt, fünf Mal täglich gibt es Astronautennahrung. Sie kann auch nicht sprechen, sie kann nicht stehen, nicht gehen, nicht sitzen, sie kann ihren Kopf nicht halten, sie kann nicht greifen. Lisa Maria* lebt seit ihrer Geburt mit einer Behinderung. Sie ist sechs Jahre alt. Und sie weiß genau, was sie mag und was sie nicht mag.
Das Mädchen kann hören und sehen, leidet jedoch unter einer sehr starken Kurzsichtigkeit und nimmt die Welt vor allem über Berührungen wahr. Wenn ihre Angehörigen ihr über den Rücken kratzen oder ihre Stirn streicheln oder ihre Knie kitzeln, wird ihr Gesicht weich, ihre blauen Augen werden klein und ihre Mundwinkel schieben sich nach oben. Seit 18. März aber dürfen Lisa Marias Angehörige sich ihr auf diese Weise nicht mehr nähern. Das Pflege- und Förderzentrum in Perchtoldsdorf, eine Einrichtung des Landes Niederösterreich, in dem das Mädchen lebt, verbietet aufgrund der Corona-Pandemie allen Gästen strikt den Zugang. Zwar dürfen die kleinen Bewohnerinnen und Bewohner einmal pro Woche für rund eine Stunde besucht werden – allerdings getrennt durch einen Stahlgitterzaun, mit Maske und mit zwei Meter Mindestabstand. Es sei „wie im Gefängnis", sagt Lisa Marias Mutter Cristina-Maria T., 35. „Lisa Maria hört uns, aber sie versteht nicht, warum wir sie nicht anfassen." Das Mädchen schreie und weine, die Situation sei „ein einziger Horror".
Während das gesamte Land erwacht, auf den Wanderhütten wieder die Bierflaschen und Spritzergläser gereicht werden, die Grenzbalken langsam wieder hochgehen und man wieder zum H&M Spaghettiträgerleiberln kaufen gehen kann, verharren ganze Bereiche in der Finsternis des Lockdown. Etwa die Seniorenheime. Oder die ausländischen 24-Stunden-Pflegerinnen, die nach Monaten harter Arbeit nicht nach Hause fahren dürfen. Oder die Demenzkranken, die alleine in den Heimen sitzen. Und Kinder wie Lisa Maria, ohne konkrete Perspektive auf Besserung.
Die wenigen Erleichterungen, die in diesem Bereich greifen, also die Ermöglichung kurzer Besuche mit viel räumlichem Abstand, sind selbst für Erwachsene schwer zu ertragen – geschweige denn für Kinder wie Lisa Maria. Berührungen sind ihr ganzes Leben, und genau davon ist sie seit über zwei Monaten abgeschnitten.
Erst kürzlich hat ein Neuropädiater das Mädchen untersucht. Sein Zustand sei trotz Isolation in Ordnung. Aber der Arzt empfehle dringend den körperlichen Kontakt zur Familie, sagt Susanne Wiesner, 47. Sie selbst und ihr Mann Michael, 50 Jahre alt, zählen sich auch dazu. Das kinderlose Paar spielt in Lisa Marias Leben eine besondere Rolle.
Susanne Wiesner kennt Lisa Maria seit dem Tag ihrer Geburt. Seit 25 Jahren arbeitet die Frau als Intensivkrankenschwester, sie war dabei, als Lisa Maria als Frühchen in der 34. Woche nach einer Plazentaablösung und einem Notkaiserschnitt mit Behinderung auf die Welt gebracht worden ist. Die Ärzte prophezeiten dem Kind einen frühen Tod. Monatelang sollte es im Spital bleiben, nach wenigen Lebenswochen gar über eine halbe Stunde lang keine Herztöne mehr aufweisen und für tot gehalten werden – um dann wieder von allein tief zu atmen zu beginnen. Es war die Zeit, in der sich zwischen Susanne Wiesner und der kleinen Lisa Maria „eine Liebe" entwickelte – das sagt nicht nur Wiesner, sondern selbst Lisa Marias leibliche Mutter. „Susanne ist für meine Tochter wie eine Mama", sagt Cristina-Maria T. „Es ist, als würde sie eine Seele zusammenführen." Diese Verbindung, sagt sie, wollte sie nicht stören. „Meine Tochter braucht jede Hilfe, die sie bekommen kann." Die Wiesners haben sogar eine weitreichende Vollmacht der obsorgeberechtigten Eltern bekommen.
Deshalb führen sie heute mit aller Kraft den Kampf, Lisa Marias Alltag wieder normal zu machen. „Wir haben einfach Angst, dass sie zurückfällt", sagt Susanne Wiesner. Denn Lisa Marias Geschichte war schon vor Corona kompliziert.
Lisa Marias Mutter, eine rumänischstämmige Fabriksarbeiterin, sagt, nach der Geburt und noch Monate danach sei sie am Boden zerstört gewesen. Ein Kind mit einer derart schweren Behinderung in ihrer 53-Quadratmeter-Wohnung in Rudolfsheim-Fünfhaus mit zwei weiteren Kindern zu betreuen, das traute sie sich damals nicht zu. Deshalb sprang die MA 11 ein, die Wiener Kinder- und Jugendhilfe. Die Eltern blieben zwar die Vertreter Lisa Marias, die Behörde übernahm allerdings Obsorge und Pflege. Lisa Maria kam mit fünf Monaten in die Kinderwohngemeinschaft Laaerberg. Mit zwei Jahren wurde bei ihr schließlich der multiresistente Krankenhauskeim MRSA nachgewiesen – eine Folge häufiger Erkrankungen und zahlreicher Spitalsaufenthalte. Infolge dieser Diagnose konnte man in ihrer Wohngemeinschaft die spezielle Pflege, die das Mädchen seither benötigte, nicht aufbringen. Also wurde ein neues Heim gefunden: das Hilde Umdasch Haus der Malteser Kinderhilfe in Amstetten.
Recht bald nach ihrer Ankunft wurde sie dort in einem Raum isoliert. Zweieinhalb Jahre lang durfte man Lisa Marias Zimmer nur in medizinischer Vollmontur betreten, mit Kittel, Haube, Mundschutz und Handschuhen. Sie könne nämlich mit dem Keim andere anstecken, so die Sorge. Für diese lange Zeit sah Lisa Maria keine menschlichen Gesichter. Das Mädchen hat, wenn man so will, bereits lange vor der Corona-Pandemie ihren ganz persönlichen Lockdown erlitten.
Lisa Marias Eltern, gemeinsam mit den Bonuseltern Wiesner, kämpften lange für eine andere Unterbringung – dass dies gelang, nennen die Wiesners heute „Befreiung". Lisa Maria erhielt schließlich 60.000 Euro Entschädigung für die Freiheitsentziehung – von der Finanzprokuratur, also der Republik Österreich. Denn die Wiener MA 11 als staatliche Jugendwohlfahrtsbehörde hatte die Unterbringung in Amstetten bestimmt, erklärt Constanze Emesz, die Anwältin der Familie.
Danach fand die MA 11 für das Kind den Platz in Perchtoldsdorf, seinem heutigen Wohnort. Dort änderte sich das Leben des Mädchens radikal zum Positiven. Es blühte auf, erzählt Susanne Wiesner. Die Kleine legte an Gewicht zu, wuchs und wurde aufgeweckter. Selbst der multiresistente Keim - der in Amstetten stets als Grund für ihre Isolation angegeben worden war - wurde in Perchtoldsdorf „saniert", wie es im Fachjargon heißt.
Zwar ist er bis heute nicht gänzlich verschwunden, aber das führte nicht zu erneuter Isolation. Mit weiteren Kindern teilt sie sich das Zimmer, sie besuchte auch den Kindergarten und ab Herbst muss sie in die Schule. Außerdem war das Mädchen in Perchtoldsdorf auch geografisch näher bei den Eltern, Geschwistern und den engagierten Wiesners.
Letztere kamen Lisa Maria nahezu täglich nachmittags besuchen, machten Ausflüge und verbrachten mit ihr die Stunden bis zum Schlafengehen. Und nun ist diese Zuneigung, auf die Lisa Maria zählt, einfach weg.
Wer aber kann verfügen, dass sich ihre Situation ändert? Wer diese Frage stellt, wird im Kreis geschickt. Das Gesundheitsministerium unter Rudolf Anschober (Grüne) antwortet auf Anfrage, es gebe zwar Empfehlungen des Ministeriums, wie etwa die Abstandsregeln, allerdings seien diese lediglich ein „Rahmen für die Länder und Heimträger". Die "Gegebenheiten vor Ort und die spezifische Situation einzelner Bewohnerinnen und Bewohner verlangen aber immer wieder nach individuellen Lösungen", so das Ministerium auf Anfrage. Das jeweilige Heim dürfe „letztlich selbst entscheiden, wie es mit den Besuchen in begründbaren Einzelfällen umgeht, es sei denn, es gibt anderslautende, rechtlich bindende Vorgaben von den Bundesländern".
Soll heißen: Heim und Land Niederösterreich sind zuständig.
Und in Lisa Marias Fall ein stückweit auch die Wiener MA 11. Denn in ihrem Auftrag wurde das Mädchen einst nach Perchtoldsdorf überstellt.
Anfrage bei der MA 11: Hat sie sich für andere Besuchsregelungen für Lisa Maria eingesetzt? „Wir wissen, dass die Maßnahmen regelmäßig evaluiert werden", sagt Ingrid Pöschmann, Leiterin des Referats Inklusion bei der Wiener MA 11. Allerdings: Man müsse dafür Sorge tragen, das Risiko möglichst zu minimieren. Im Übrigen „hat die Aufsicht über die Unterbringung des Mädchens das Land Niederösterreich", sagt Pöschmann. „Die MA 11 ist nur der Auftraggeber."
Und was sagen das Heim selbst und das Land Niederösterreich dazu? Im Haus in Perchtoldsdorf, einer Einrichtung des Landes, verweist man auf die Abteilung Landeskliniken und Landesbetreuungszentren. Von wo man wiederum an die niederösterreichische Landesgesundheitsagentur weitergelotst wird. Dort schließlich sagt man: „Sobald es die Aussichten weiterer Lockerungen gibt, werden wir diese selbstverständlich zügig umsetzen." Und: „Möglicherweise gibt es daher seitens der Bundesregierung bald neue Empfehlungen."
Soll heißen: Die Lockerungen hängen von dem ab, was das Ministerium sagt. Womit man wieder bei Rudolf Anschober landet.
Der Behindertenanwalt des Bundes, Hansjörg Hofer, weiß um die nervenaufreibende Praxis mit den Besuchsregelungen innerhalb der Länder und sagt, sie seien recht unterschiedlich organisiert und oft nicht transparent. Niederösterreich beispielsweise sei im Gegensatz etwa zu Salzburg als eher streng zu bezeichnen.
Aber wer ist denn nun am Ende für die Besuchsbeschränkungen zuständig – Bund oder Land? „Der Bereich Inklusionspolitik ist Ländersache", sagt Christine Steger, Vorsitzende des Unabhängigen Monitoringausschusses zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Inhaltlich sei das schon richtig, sagt die Menschenrechtsjuristin Marianne Schulze. „Nur geht es da ja auch um Empfehlungen aus dem Gesundheitsministerium und die greifen – auch rein atmosphärisch -ziemlich durch."
Auf die Frage, was denn das Land Niederösterreich getan habe, um für Lisa Marias Situation eine „individuelle Lösung" zu finden, wie es das Ministerium vorschlägt, heißt es nach Falter-Anfrage von der niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur: „Hinsichtlich des Falles [...] könnte es durchaus eine praktikable und individuelle Lösung geben. Wir schauen uns derzeit die verschiedenen Möglichkeiten an." Immerhin.
*Name von der Redaktion geändert. Zum Schutz des höchstpersönlichen Lebensbereiches des Kindes verbietet das Mediengesetz eine identifizierende Berichterstattung.
Mit freundlicher Genehmigung übernommen aus dem FALTER 21/20 vom 20.05.2020: https://www.falter.at/zeitung/ausgabe/202021

