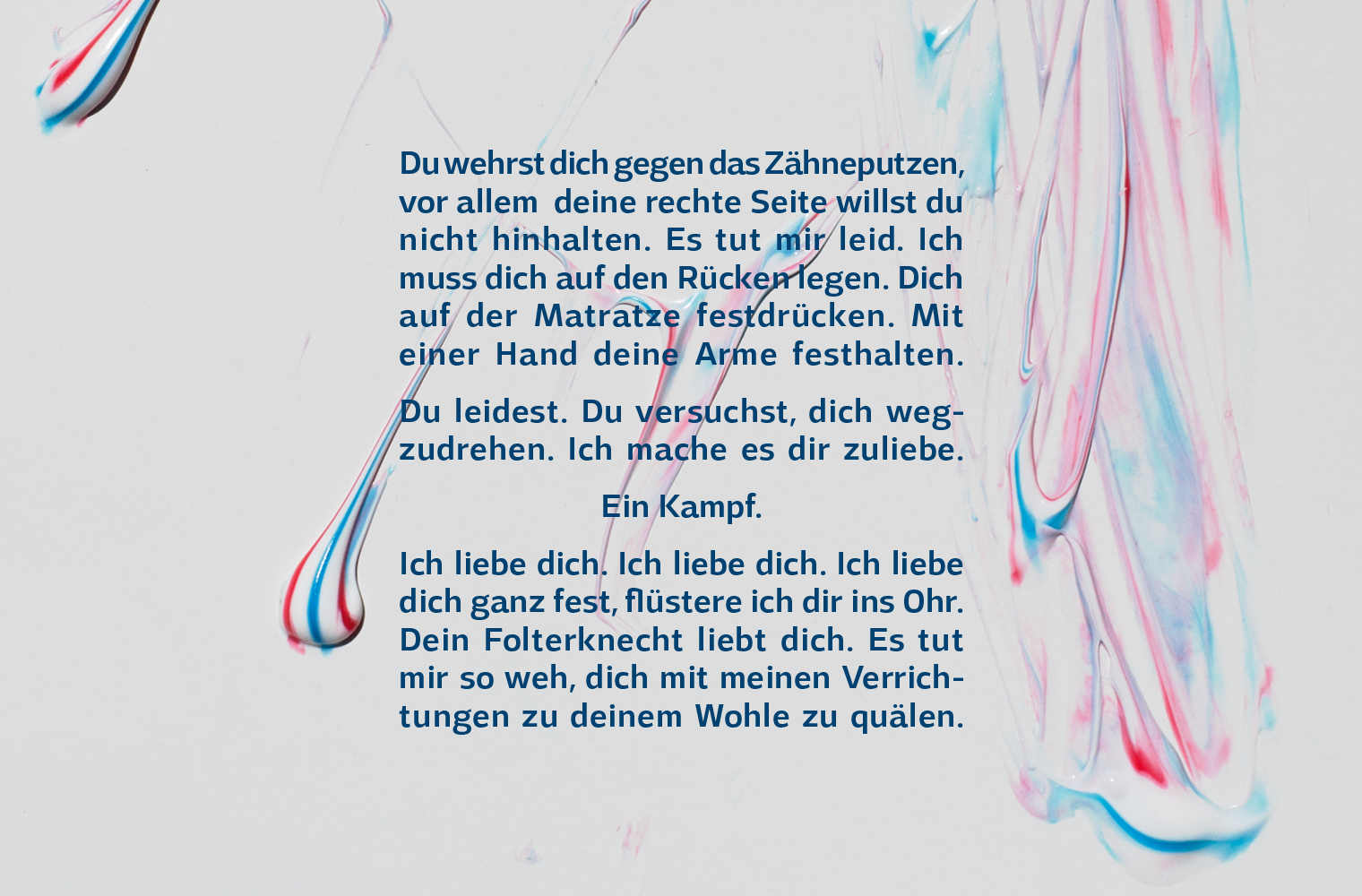
Permanente Vaterschaft
Welche Tätigkeiten nehmen Väter von erwachsenen Menschen mit Behinderung in ihrer Familie wahr? Welche Handlungsstrukturen und -motive lassen sich aus ihrer Sicht rekonstruieren? Diesen Fragen wurde in der qualitativen Studie: „Permanente Vaterschaft“ nachgegangen. Bisher standen explizit Väter im heilpädagogischen Kontext selten im Fokus. Insgesamt elf Väter (Jahrgänge 1929 bis 1953) von erwachsenen Menschen mit einer geistigen Behinderung erzählten für diese Untersuchung ihre Lebensgeschichte. Die biographischen Rekonstruktionen zeigten deutlich, dass diese Väter zentral und prägend für das Familiensystem waren und sind. Zudem lassen sie sich nicht nur auf die Rolle als Vater eines Kindes mit Behinderung beschränken. Selbstverständlich und gleichzeitig sind sie auch Männer mit einer eigenen Familiengeschichte und -tradition, sie waren / sind Ehepartner, hatten / haben Berufe und üben Freizeitinteressen aus. Gerade diese erweiterte Perspektive kann eine wichtige Ressource in der heilpädagogischen Zusammenarbeit mit ihnen selbst und ihrem Familiensystem eröffnen. Eine Hinführung.
Eine Hinführung
Väter von Kindern2 mit geistiger Behinderung im Erwachsenenalter werden in der heilpädagogischen Praxis bislang kaum berücksichtigt. Aus Sicht professioneller Mitarbeiter_innen werden Väter von Kindern mit Behinderung oftmals als „fliehende Väter“ (diesbezüglich kritisch Andreas Fröhlich [2007]) wahrgenommen, die nach der Geburt eines Kindes ihre Familie verlassen. Dafür wird der Fokus (wenn auch nicht ausreichend) auf die Mutter als Hauptbetreuungs- und Bezugsperson und ihre „Care-Arbeit“ gelegt. Dieser Sicht kommt die soziale Rolle der „starken“ Frau und von „Pflege ist weiblich“ (Hammer 2012, S. 42) entgegen. Die Väter führen bis dato in der heilpädagogischen Praxis eher ein Schattendasein (vgl. Kallenbach 1997, S. 25).
Dem entspricht, dass Väter von Kindern mit Behinderung in der deutschsprachigen (ebenso in der angloamerikanischen3) heilpädagogischen Literatur selten thematisiert werden.4 Es gibt bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Arbeit keine expliziten Untersuchungen, wie diese Väter ihre „Vaterschaft“ wahrnehmen und erleben, welche Tätigkeiten sie in der Familie übernehmen. Väter von erwachsenen Menschen mit Behinderung werden höchstens am Rande erwähnt (vgl. Hellmann/Borchers/Olejniczak 2007, S. 172f.). Wenn Eltern zum Gegenstand heilpädagogischer Untersuchungen gemacht werden, dann wird hierbei meistens die Mutter fokussiert und deren Perspektive als „Elternperspektive“ ausgegeben (Stichwort: „alleinige Bedeutung der Mutter“) (vgl. u. a. Kallenbach 1999b, S. 24).
Allerdings wird aus der Literatur auch ersichtlich, dass Väter nicht nur „fliehende Väter“ sind. In einer empirischen Untersuchung zur Situation von Eltern erwachsener Kinder mit einer geistigen Behinderung in Berlin (Projekt ElFamBe5) wurde deutlich, dass diese öfter den Status „verheiratet“ aufweisen als die Eltern in der Gesamtberliner Bevölkerung (der jeweiligen Alterskohorte) (vgl. u. a. Schmidt 2012, S. 211). Zudem gibt es Hinweise darauf, dass der Partner oder die Partnerin jeweils wichtigste Unterstützungsperson ist (vgl. Schmidt 2015a, S. 34f. u. vgl. Stamm 2009, S. 37f.). Den Vätern, die mit ihrer erwachsenen Tochter oder ihrem erwachsenen Sohn mit geistiger Behinderung zusammen wohnen, kommt offensichtlich eine größere Bedeutung zu, als dies bislang wahrgenommen wurde. Wenn aus rehabilitationspädagogischer Perspektive für diese Väter adäquate heilpädagogische Unterstützungsangebote, entsprechende Beratungskonzepte oder anderweitige rehabilitationspädagogische Hilfen entwickelt werden sollen, dann muss zunächst überhaupt erst einmal eine Vorstellung darüber gewonnen werden, was unter „permanenter Vaterschaft“6 zu verstehen ist. In der vorliegenden Untersuchung wird deshalb der Fokus auf Väter von erwachsenen Kindern mit geistiger Behinderung gelegt.
Intention dieser Studie
Hauptintention dieser Studie war es, grundlegende Erkenntnisse zur „permanenten Vaterschaft“ aus der Sicht dieser Väter zu erlangen. Es soll ein Zugang zu und eine Annäherung an ihre Perspektive gefunden werden. Sie sollten selbst zu Wort kommen und mit Hilfe von Fallrekonstruktionen soll ihr Verständnis von „permanenter Vaterschaft“ rekonstruiert werden. Dabei liegt der Studie die Forschungsthese zugrunde, dass sich die aktuelle Lebenssituation der Väter erst vor dem Hintergrund ihrer Genese bzw. Biographie begreifen lässt; nur dadurch wird ein Verständnis der betroffenen Väter ermöglicht.
Fallgeschichte Herr Reimer7 „… aber eigentlich sind wir sehr zufrieden mit unserem Leben.“
Um einen ersten Einblick in eine aktuelle Lebenssituation von Vätern zu bekommen, stelle ich Herrn Reimer vor. Diese Fallgeschichte war Bestandteil vom Projekt ElFamBe und der Dissertation:
Herr Reimer ist 67 Jahre alt. Er lebt mit seiner Tochter, die eine Schwermehrfach-Behinderung hat und seiner Ehefrau in einer Drei-Zimmerwohnung in Berlin. Herr Reimer hatte vor einigen Jahren einen Herzinfarkt und ist daraufhin berentet worden. Seine Frau ist noch berufstätig und übernimmt die Pflege der Tochter. Seine Tochter besucht tagsüber eine Werkstatt für Behinderte Menschen (WfbM).
In der Folge erzähle ich seine Lebensgeschichte mit einigen zentralen biographischen Hintergrundinformationen, um sein Gewordensein nachzuzeichnen.
Herrn Reimers Lebensgeschichte (aus Schmidt 2015b, S. 66–68)
Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, im Jahr 1946, kommt Herr Reimer in Westberlin zur Welt. Er wird in eine Patchworkfamilie hinein geboren, in der alle Geschwister verschiedene Väter haben. Der Vater seines ältesten Bruders lebt mit der Mutter und zwei seiner Schwestern zusammen. Bei seinem biologischen Vater, den er kennenlernt, mit dem er aber kaum Kontakt hat, lebt noch eine Halbschwester. Herr Reimer selbst wächst bei seinem Onkel auf, da die Zweiraumwohnung der Mutter zu klein für alle ist. Herr Reimer: „Dit warn sojar, ja doch, zwei Zimmer, und da konnte ich natürlich da nich hinjehen.“ Und weiter: „Aber mein Onkel hatte nen kleenet Problem. ALKOHOL. Und da musste ick als kleener Junge in Laden gehen und was zu trinken holen, uff Pump.“
Mit sieben Jahren wird Herr Reimer in verschiedenen Westberliner Kinderheimen untergebracht.8 In einem Kinderheim kommt er durch einen Heimerzieher zum Handball. Den Kontakt zu seiner Mutter und zu seinem Stiefvater erhält er während dieser Zeit aufrecht. Es finden Treffen statt, bei denen Herr Reimer mit seinem Stiefvater Lebensmittel stiehlt. Herr Reimer: „Mein Stiefvater hat Hühner geholt, und ick bin als kleener Junge Kartoffeln stoppeln gejangen.“ Mit 15 Jahren beginnt Herr Reimer im Kinderheim eine Ausbildung zum Verkäufer. Da seine Geschwister zwei Jahre später ausziehen und nun Platz für ihn in der Wohnung ist, zieht er mit 18 Jahren zu seiner Mutter und zum Stiefvater. Der Stiefvater ist gewalttätig gegenüber seiner Mutter und der Alkoholkonsum in der Familie war auch hier sehr hoch. Herr Reimer: „Er hat auf dem Bau gearbeitet, Mauerputz, und da trinken se alle Alkohol, naja und da blieb es nicht aus. Aber meine Mutter zu schlagen, fand ick einfach nicht gut.“ Gewalttaten ihm gegenüber benennt Herr Reimer in seiner Erzählung nicht, jedoch bewertet er die „Zucht und Ordnung“ in den Kinderheimen als positiv.
Mit 18 Jahren gründet Herr Reimer einen Handballverein am Wohnort seiner Familie und beendet im Folgejahr seine Ausbildung. Danach zieht er in eine eigene Einzimmerwohnung. Bald darauf, im Jahr 1968, mit 21 Jahren, heiratet er eine Frau, die er über seine Herkunftsfamilie kennt. Sieben Jahre später wird die Tochter Elisabeth geboren, die mit einer Behinderung zur Welt kommt. Schuldzuweisungen zwischen den Ehepartnern spielen in der Folgezeit eine Rolle. Als seine Tochter zwei Jahre alt ist, lassen sich Herr und Frau Reimer scheiden. Zu dieser Zeit arbeitet Herr Reimer als Lebensmittellieferant. Er überlässt seiner Frau und der Tochter die Wohnung und versorgt sie finanziell. Im Jahr 1982 stirbt seine Exfrau an einer schweren Krankheit, woraufhin Elisabeth für ein Jahr ins Heim kommt. So wie er erzählt, erfährt Herr Reimer von diesem Vorfall erst im Nachhinein. Über den Handballverein, den Herr Reimer nach wie vor leitet, lernt er im Jahr 1984 seine zweite Frau kennen, die er bald heiratet. Sie ziehen in eine gemeinsame Wohnung. Einen Monat später holen die beiden seine Tochter Elisabeth aus dem Heim. Ab sofort wohnt sie bei ihnen. Herr Reimer: „(…) im Heim, naja. Da sind wa dann nen paar Mal hinjefahren. Da lach sie dann noch Mittag um elfe im Bette. Dit hat uns natürlich och nich so jefallen. Aber eben, wie jesacht, der Entschluss stand fest, dass wir sie eben mit nach Hause nehmen.“
Finanziell geht es der kleinen Familie mittlerweile gut. Beide, Herr Reimer und seine Frau, verfügen über ein festes Gehalt. Sie wohnen in einer Fünf-Zimmer-Wohnung und besitzen ein Auto, Marke deutsche Oberklasse. Besondere Ereignisse in den folgenden 20 Jahren sind jährlich mehrmalige Familienurlaube innerhalb Deutschlands. Herr Reimer: „Ich hab nun das Glück jehabt, hab ne jute zweete Frau erwüscht. Die WIRKLICH wat druff hat, die sich sehr, sehr viel Mühe um die Tochter jibt. Och SIE gibt sich Mühe, in ihrer Art, wie sie es kann, aber eigentlich sind wir sehr zufrieden mit unserem Leben.“
Im Jahr 2004 erleidet Herr Reimer einen Herzinfarkt. Kurz darauf geht die Firma, bei der er arbeitet, pleite, und er wird entlassen. Bedingt durch den Arbeitsplatzverlust wird er erwerbslos, seit 2006 ist er in Rente. Hierdurch wird ein Umzug in eine kleinere Wohnung notwendig. Nahezu zeitgleich erfährt Herr Reimer, dass seine Mutter vor drei Jahren gestorben ist. Er wurde darüber nicht informiert, konnte sich nicht von ihr verabschieden oder an ihrer Beerdigung teilnehmen.
Seit Renteneintritt übernimmt Herr Reimer den Haushalt, und seine Frau geht arbeiten. Sie ist als pädagogische Hilfskraft in einer Sonderschule tätig. Hierdurch profitiert auch Elisabeth, die von Frau Reimer und ihrem Vater versorgt wird. Herr Reimer: „Sie ist ja ihre Ärztin. Die macht dat schon recht gut.“
Im Jahr 2010 verliert die Familie die Schwiegermutter und Oma (die Mutter von Herrn Reimers zweiter Frau) sowie ihren Hund, der für Elisabeth ein treuer Freund war. Herr Reimer: „Dit war och wieder son Einschnitt, weil die Oma dann weg war. Dann hatten wir nen Hund, der ist och jestorben. War och ihr Liebling, ja. Naja, dit sind so Sachen, Nackenschläge! Aber damit müssen wa nun mal leben.“
Zum Forschungsdesign
Um einen möglichst unverstellten Blick auf „permanente Vaterschaft“, wie z. B. auf Herrn Reimer, eröffnen zu können, bot sich aufgrund der Intention dieser Studie ein abduktiver (offener) Zugang an. Die Wahl des Zugangs-, Erhebungs- und Auswertungsmittels für die Datenbasis des beschriebenen Phänomens (siehe Hinführung) fiel auf den biographietheoretischen Forschungsansatz der „Interpretativen Sozialforschung“ nach Gabriele Rosenthal (1995, 2008). Mit Hilfe dieses Vorgehens soll das Verständnis von „permanenter Vaterschaft“ rekonstruiert werden. Dabei geht es um eine Beschreibung und nicht um eine Bewertung des Selbstverständnisses oder der Handlungen von Vätern. Diese Herangehensweise ermöglicht es, die Lebensgeschichte der Väter in ihrer Entwicklung wie auch in der gegenwärtigen Deutung immer als beides zugleich zu sehen und nachvollziehen zu können: als „[...] ein individuelles und ein soziales Produkt“ (Rosenthal 2008, S. 137). So können u. a. die Familienhintergründe und unterschiedlichen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in ihrer Bedeutung für den Einzelnen mit in den Blick genommen werden. Es wird so auch möglich, sich ihrem Gewordensein, auch bezüglich ihrer Tätigkeiten in der Familie, anzunähern, da nicht nur die aktuelle Lebenssituation oder ein ausgewählter Ausschnitt der Lebensgeschichte betrachtet wird.
Für die Studie erzählten neben Herrn Reimer weitere zehn Väter (Jahrgänge 1929–1953) ihre Lebensgeschichte. Drei9 weitere sehr ausführliche lebensgeschichtliche Rekonstruktionen können in der Dissertationsschrift nachgelesen werden. Am Umfang der Fallgeschichten wird die Komplexität der Genese der Väter deutlich, gleichzeitig wird es immer nur eine Annäherung eines Verstehens bleiben (vgl. Rosenthal / Fischer-Rosenthal 2012, S. 461).
Überlegungen zur Rekonstruktion der Fallgeschichte „Herr Reimer“ 10
Aber welche Familientätigkeiten übernimmt und welche Handlungsstrukturen zeigt Herr Reimer nun als Vater? In der Folge sollen einige Überlegungen zur Fallgeschichte und seiner Präsentation im Interview11 vorgestellt werden. Sie sind alle in den für diesen Zugang dringend erforderlichen Interpretationsgruppen erarbeitet worden. Herr Reimer wurde in der Studie als „der sich unterordnende, stille, nach Harmonie strebende Versorger“ beschrieben.
„Diesen Typ kennzeichnet, dass er sich in Familie und Beruf unterordnet – er versucht Streit aus dem Weg zu gehen, um die Harmonie in der Familie erhalten zu können. Nach Außen präsentiert er keine Gefühle und hält seine Vorstellungen verdeckt, er neigt zum Nachgeben. Wenn er nicht mehr gebraucht wird, zieht er sich eher zurück. Sein Gegenüber muss die Beziehung halten, sonst lässt er sie abbrechen. Vor dem Hintergrund seiner Genese ist dieses Beziehungsmuster eine Schutzfunktion, aber auch die Erfahrung, dass ein Widerspruch schlimme Folgen nach sich ziehen kann. So erlebten die Väter ihre Kindheit geprägt von Armut und Gewalt, sie waren für die Versorgung mit verantwortlich, fühlten sich aber sonst überflüssig. Sie erlebten viele Wechsel der Bezugspersonen, wurden in der Verwandtschaft herumgereicht oder wechselten häufig die Kinderheime. Feste Bindungen zu einer Bezugsperson konnten so kaum entstehen: „Naja, dit sind so Sachen, Nackenschläge! Aber damit müssen wa nun mal leben.“ So können Abbrüche zur Herkunftsfamilie und den Kindern aus früherenBeziehungen, zu eigentlich nahestehenden Menschen, entstehen.
Ein Wendepunkt in der Dauerhaftigkeit von Beziehungen bei diesem Vatertyp kann seine Partnerin darstellen, wenn sie es schafft, eine feste und innige Beziehung zu ihm aufzubauen und ihn zur Pflege vorhandener Beziehungen zu ermutigen. Diese Väter können mit Hilfe ihrer Partnerin beschützende Bedingungen in der Familie für ihr Kind mit Behinderung bieten. So kann z. B. Herr REIMER heute für sich ein „spätes Familienglück“ erleben. Eine Familiensituation, welche sich vermutlich die Väter in ihrer eigenen Kindheit gewünscht hätten, kann er jetzt sich erarbeiten.“ (Schmidt 2017, S. 371)
Für die heilpädagogische Praxis ist die Fallgeschichte „Herr Reimer“ interessant, da seine „permanente Vaterschaft“ nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist und dennoch das Familiensystem und -fundament mit seiner Tochter mit Behinderung sehr prägt.
Ergebnisse
Die interviewten Väter haben jeweils ihre persönlichen Möglichkeiten ihrer „permanenten Vaterschaftsausübung“ gefunden. Ihre lebensgeschichtlichen Rekonstruktionen veranschaulichen, dass sie zentrale Positionen in ihren Familien einnehmen und prägend sind. Mit der in der Studie vorgenommenen Typologie12 bin ich der Frage nachgegangen, welche idealtypischen Akzentsetzungen und Ausformungen die „permanente Vaterschaft“ aufweisen kann. Mit den von mir rekonstruierten Vätertypen ist auch – wichtig zum Beispiel für die heilpädagogische Arbeit – die Frage nach der heilpädagogischen Ansprechbarkeit der Väter und somit der Kontakt zu ihrem erwachsenen Kind mit Behinderung verbunden. Es kristallisierten sich folgende drei „idealtypische“ Vätertypen heraus:13
Diese Positionen und Familientätigkeiten sind dabei nicht statisch, sondern unterliegen der Familiendynamik. Väter sind prinzipiell bereit, familiäre Tätigkeiten zu übernehmen, auch als Hauptaufgabe und Ansprechperson für ihr erwachsenes Kind mit Behinderung in der Familie. Im Sinne dieser Typologie kann die Vaterschaft „Herr Reimer“ dem Typ „stiller Versorger“ zugeordnet werden.
Die verallgemeinerten fallübergreifenden Ergebnisse zeigen, dass sowohl die Familientätigkeit als auch die Handlungs- und Orientierungsmuster der Väter bezüglich ihres (erwachsenes) Kindes mit Behinderung ein Wechselspiel zwischen vertrauten und bekannten Familientraditionen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sind. Dabei ändern sich bewährte Handlungsstrukturen mit der Geburt eines Kindes mit Behinderung nicht zwingend.15 Die in der Dissertationsschrift befragten Väter haben sich mithilfe ihres Verständnisses von „permanenter Vaterschaft“ vielmehr ihren Weg im Leben und bei der Wahrnehmung ihrer Vaterschaft geschaffen. Sie empfinden bis heute ein permanentes Gebrauchtwerden und Verantwortung – sie üben bis in heute ihre „permanente Vaterschaft“ aus.
Aus den Rekonstruktionen kristallisiert sich auch heraus, dass das jeweilige Selbstverständnis von Vaterschaft auch transgenerational bestimmt ist. Die handlungsprägenden Strukturen sind nicht immer offensichtlich, die handlungsentscheidenden Momente liegen dabei häufig verdeckt. Es zeigt sich, dass es einer Gesamtbetrachtung bedarf, um die aktuelle Situation zu verstehen. Die Väter empfinden ihr Zusammenleben mit ihrem Kind mit Behinderung als sinnvoll – auch wenn die Außenperspektive dies nicht immer erahnen lässt. Dabei gibt es kein „richtig“ oder „falsch“, die individuelle Familiendynamik besitzt eine zentrale Rolle.
Ausblick – Bedeutung für Forschung und Behindertenhilfe
Die mit Hilfe dieses Ansatzes gewonnenen Erkenntnisse sollen die Basis für weitere Forschungen zum Umgang mit Vätern im heilpädagogischen Kontext sein und helfen, Begleitungs- und Unterstützungsangebote zu entwickeln. Mit der idealtypischen Konstruktion (Typologie)16 wird eine Vergleichbarkeitsebene und Differenzierung zur Verfügung gestellt (vgl. Soeffner 2012, S. 173). Daraus ergeben sich für die praktische Arbeit Konsequenzen, doch trotz aller „Typologie“ bleibt jede Biographie individuell. Es entsteht ein Spannungsfeld, welches sich in Gänze strukturell nicht auflösen lässt, aber für den Diskurs der Bedeutung zu Vätern von erwachsenen Menschen mit Behinderung in der Behindertenhilfe und der heilpädagogischen Forschung durchaus gewinnbringend und zielführend sein kann.17
Außerdem zeigen die Ergebnisse den Bedarf eines Perspektivwechsels im Umgang mit Vätern von erwachsenen Menschen mit einer geistigen Behinderung sowohl in der heilpädagogischen Praxis wie in der Forschung als auch in der Aus- und Weiterbildung auf. Dies begründet sich aus den verallgemeinerten Ergebnissen und der erarbeiteten Typologie. Es ergeben sich Forderungen zu:
einer gendersensiblen Betrachtung mit einer Erweiterung auf die Familientätigkeit,
einer Angebotsstruktur für die Väterarbeit,
einer „ethnographischen Kompetenz“18 mit einer Herkunfts- und Generationensensibilität und
einer Reflexion des Auszugsparadigmas hin zur begleitenden Vorsorge.
Diese Studie kann nur ein erster Schritt hin zu diesem Perspektivwechsel in der heilpädagogischen Praxis und Forschung sein und will ihn anregen. Hier sind die historisch-gesellschaftlichen Diskurse und die Diskurse in der heilpädagogischen Praxis und Forschung eng miteinander verknüpft. Es ist ein Prozess, welcher Zeit verlangt, sich aber lohnt.
Literatur
Burtscher, R; Heyberger, D. & Schmidt, Th. (Hrsg.) (2015): Die „unerhörten“ Eltern. Eltern zwischen Fürsorge und Selbstsorge. Unter Mitwirkung von Driesener, Katja; Schuppan, Steffi und Tröndle, Judith. Marburg: Lebenshilfe-Verlag.
Debora, D.; Duncan, M. & Rachel, M. (2016): Fathers of people with intellectual disability: A review of the literature. In: Journal of Intellectual Disabilities 21 (2), S. 175–196.
Flick, U. (2011): Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. Vollständig überarbeitete und erweiterte Neuausgabe, 4. Auflage. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
Fröhlich, A. (2007): Die Einsamkeit des Vater-Seins. Väter in der Frühförderung. In: Frühförderung interdisziplinär 26 (3), S. 99–106.
Hammer, E. (2012): Pflege? – Männersache! Männer in der Angehörigenpflege. In: Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit (3), S. 42–49.
Hellmann, M.; Borchers, A. & Olejniczak, C. (2007): Perspektiven alternder Menschen mit schwerster Behinderung in der Familie. Abschlussbericht. ies – Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung GmbH an der Universität Hannover (Hrsg.). Online verfügbar unter http://www.ies.uni-hannover.de/fileadmin/download/Behindert_in_Familie_01.pdf [Stand: 15.05.2018].
Hinze, D. (1992): Väter behinderter Kinder. Ihre besonderen Schwierigkeiten und Chancen. In: Geistige Behinderung (2), S. 135–142.
Kallenbach, K. (1997): Väter schwerstbehinderter Kinder. Projektbericht aus der Forschungsgemeinschaft „Das körperbehinderte Kind“, Institut an der Universität zu Köln. Münster: Waxmann.
Kallenbach, K. (1999a): Unterstützende soziale Netzwerke in der Familie mit einem schwerst körperbehinderten Kind. In: Heilpädagogische Forschung 25 (2), S. 61–74.
Kallenbach, K. (Hrsg.) (1999b): Väter behinderter Kinder. Eindrücke aus dem Alltag. Düsseldorf: verlag selbstbestimmtes leben.
Krüger, H.-H. (2006): Entwicklungslinien, Forschungsfelder und Perspektiven der erziehungswissenschaftlichen Biographieforschung. In: Krüger, H.-H. und Marotzki, W. (Hrsg.): Handbuch erziehungswissenschaftlicher Biographieforschung. 2. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 13–33.
Rosenthal, G. (1995): Erlebte und erzählte Lebensgeschichte. Gestalt und Struktur biographischer Selbstbeschreibungen. Frankfurt/Main, New York: Campus.
Rosenthal, G. (2008): Interpretative Sozialforschung. Eine Einführung. 2., korrigierte Auflage. Weinheim und München: Juventa-Verlag.
Rosenthal, G. & Fischer-Rosenthal, W. (2012): 5.11 Analyse narrativ-biographischer Interviews. In: Flick, U.; von Kardorff, E. und Steinke, I. (Hrsg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. 9. Auflage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verlag, S. 456–468.
Schmidt, Th. (2012): Projekt ElFamBe. „Er sollte weiterhin fröhlich leben können“. In: Rektorenkonferenz Kirchlicher Hochschulen (Hrsg.): Forschung trifft Praxis. Selbstverständnis und Perspektiven der Forschung an kirchlichen Hochschulen. Freiburg im Breisgau: FEL-Verlag Forschung – Entwicklung – Lehre, S. 206–216.
Schmidt, Th. (2015a): Zahlen aus Berlin: Ergebnisse unserer Umfrage. In: Burtscher, R.; Heyberger, D. und Schmidt, Th.: Die „unerhörten“ Eltern. Eltern zwischen Fürsorge und Selbstsorge. Unter Mitwirkung von Driesener, Katja; Schuppan, Steffi und Tröndle, Judith. 1. Auflage. Marburg: Lebenshilfe-Verlag, S. 27–36.
Schmidt, Th. (2015b): Herr Reimer. In: Burtscher, R.; Heyberger, D. und Schmidt, Th.: Die „unerhörten“ Eltern. Eltern zwischen Fürsorge und Selbstsorge. Unter Mitwirkung von Driesener, Katja; Schuppan, Steffi und Tröndle, Judith. Marburg: Lebenshilfe-Verlag, S. 66–69.
Schmidt, Th. (2017): Permanente Vaterschaft – eine biographisch-rekonstruktive Fallstudie zu Vätern, die zusammen mit ihrem erwachsenen Kind mit geistiger Behinderung leben; Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin, Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, publiziert am 22.05.2017, Im Internet: http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/schmidt-thomas-2016-11-09/PDF/schmidt.pdf.
Stamm, Ch. (2009): Erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung im Elternhaus. Zur Situation von Familien, in denen erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung leben – eine empirische Studie im Kreis Minden-Lübbecke. Abschlussbericht. Universität Siegen. Zentrum für Planung und Evaluation sozialer Dienste.
Soeffner, H.-G. (2012): 3.5. Sozialwissenschaftliche Hermeneutik. In: Flick, U.; von Kardorff, E. und Steinke, I. (Hrsg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. 9. Auflage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verlag, S. 164–174.
Völter, B. (2008): Verstehende Soziale Arbeit. Zum Nutzen qualitativer Methoden für professionelle Praxis, Reflexion und Forschung. FQS Forum: Qualitative Sozialforschung (Volume 9, No. 1, Art. 56 – Januar 2008). Online verfügbar unter http://www.qualitative-research.net /fqs/article/view/327/715 [Stand: 15.05.2018].
Fußnoten
1 Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung der Dissertationsschrift: „Permanente Vaterschaft – Eine biographisch-rekonstruktive Fallstudie zu Vätern, die zusammen mit ihrem erwachsenen Kind mit geistiger Behinderung leben“, welche im März 2016 am Rehawissenschaftlichen Institut der Humboldt Universität zu Berlin eingereicht worden ist (vgl. Schmidt 2017).
2 Anmerkung zur Verwendung des Begriffes „Kind“ in diesem Artikel: Unabhängig vom Lebensalter bleiben Kinder immer Kinder ihrer Eltern, auch wenn sie erwachsen werden. Bei dieser Bezeichnung setze ich voraus, dass ein Mensch mit Behinderung nicht im Status „Kind“ verhaftet bleibt und dem Erwachsensein eine eigene Qualität zukommt. Die Bezeichnung „Kind“ gibt hier somit keine entwicklungs- und bildungspsychologische, sondern eine relationale Perspektive wieder: das Eltern-Kind-Verhältnis.
3 Debora; Duncan; Rachel (2016) beschreiben zudem einen Mangel an Informationen zu Vätern von erwachsenen Menschen mit einer geistigen Behinderung.
4 Es gibt bereits seit längerem vereinzelte Stimmen, auch Vätern von (minderjährigen) Kindern mit Behinderung mehr Beachtung zu schenken (vgl. Hinze 1992 u. vgl. Kallenbach 1999a). Auch in Fachliteratur zum Thema „Pflege“ wurden Männer als Pflegeperson bis zum Zeitpunkt der Studie kaum betrachtet (vgl. Hammer 2012, S. 4 u. vgl. Schmidt 2017, S. 40f.).
5 Projekt „Älter werdende Eltern und erwachsene Familienmitglieder mit Behinderung zu Hause. Innovative Beratungs- und Unterstützungsangebote im Ablösungsprozess“ (ElFamBe). In dem Forschungsprojekt (Mai 2010 bis Mai 2013) an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin (KHSB) war ich als Wiss. Mitarbeiter tätig.
6 In Anlehnung an den Begriff der „permanenten Elternschaft“. Diese Gedankenfigur der „permanenten Elternschaft“ deutet im heilpädagogischen Kontext an, dass sich Eltern von Menschen mit Behinderung möglicherweise lebenslang für die Pflege und Betreuung verantwortlich fühlen (vgl. u. a. Burtscher/Heyberger/Schmidt 2015, S. 14).
7 Alle Namen sind in dieser Geschichte geändert.
8 Vgl. runder Tisch Heimerziehung. Online unter: http://www.rundertisch-heimerziehung.de/downloads.htm.
9 Fallgeschichten „Paul Kaufmann“, „Georg Berg“ und „Hans Hauck“ in Schmidt 2017, S. 133–353. Die Auswahl der Biographien für eine ausführliche Fallrekonstruktion erfolgte auf dem Ergebnis von Globalanalysen nach dem Prinzip der maximalen und minimalen Kontrastierung (vgl. u. a. Rosenthal 2008, S. 87).
10 An der Fallgeschichte „Herrn Reimer“ wurde im Projekt vor allem der Aspekt eines Ablösungsprozesses betrachtet (Stichwort: „eigene Heimerfahrung“) (vgl. Schmidt 2015b, S. 66–68 und Schmidt 2017, Anlage 1, S. 436).
11 Beim Interview mit Herrn Reimer erzählte seine Frau weitestgehend die Biographie ihres Mannes, sodass Herr Reimer selbst im Interview wenig erzählte.
12 Zugangsmethodisch bedingt, schließt die Ergebnisbeschreibung mit einem kontrastiven Vergleich der Typenbildung (hier Vätertypen) ab.
13 Die ausführliche Typologie – mit Untertypen und Beschreibung – befindet sich in Schmidt (2017, S. 369ff.).
14 Weitere Rekonstruktionen können diese Typologie erweitern und ausdifferenzieren. Zudem ist die Typologie abhängig von der Fragestellung, welche an die Rekonstruktionen gestellt werden. „Typen“, auch „Untertypen“, entstehen grundsätzlich erst nach einer Rekonstruktion, dies setzt eine intensive Beschäftigung voraus; so ist ein Typ auf den „ersten Blick“ nicht zu entdecken. Es besteht die Gefahr: „Das ist ja typisch!“ (vgl. Schmidt 2017, S. 381).
15 Ein ähnliches Bild scheint sich bei Müttern von erwachsenen Menschen mit Behinderung zu zeigen (vgl. Tröndle in Schmidt 2017, S. 335).
16 Diese Logik der Bildung von Idealtypen entspricht dem Vorgehen von Max Weber.
17 Ausführlich dazu Schmidt (2017), S. 380.
18 Bettina Völter (2008) spricht von einer ethnographischen Sichtweise, „[…] die AdressatInnen der sozialen Arbeit in ihren Alltagspraktiken, ihrem Gewordensein, ihren Wünschen und ihrem ‚Eigensinn‘ kennenzulernen und zu verstehen“ (ebd.). In Verbindung mit entsprechender Haltung und Methodenwissen spricht sie dann von einer „ethnografischen Kompetenz“ (ebd.).
Thomas Schmidt, Dr. phil.
Dipl. Heilpädagoge (FH), Koordinator der Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und Angehörige der Mobilien Behindertenhilfe der Stadtmission Chemnitz e.V. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsprojekt ElFamBe. Seine Arbeitsschwerpunkte sind: Biographieforschung, Angehörigenperspektive, im Speziellen die der Väter von erwachsenen Menschen mit Behinderung. Basiskurs: „Palliative Care für Menschen mit geistiger Behinderung“.
E-Mail: tschmidti@gmx.de

