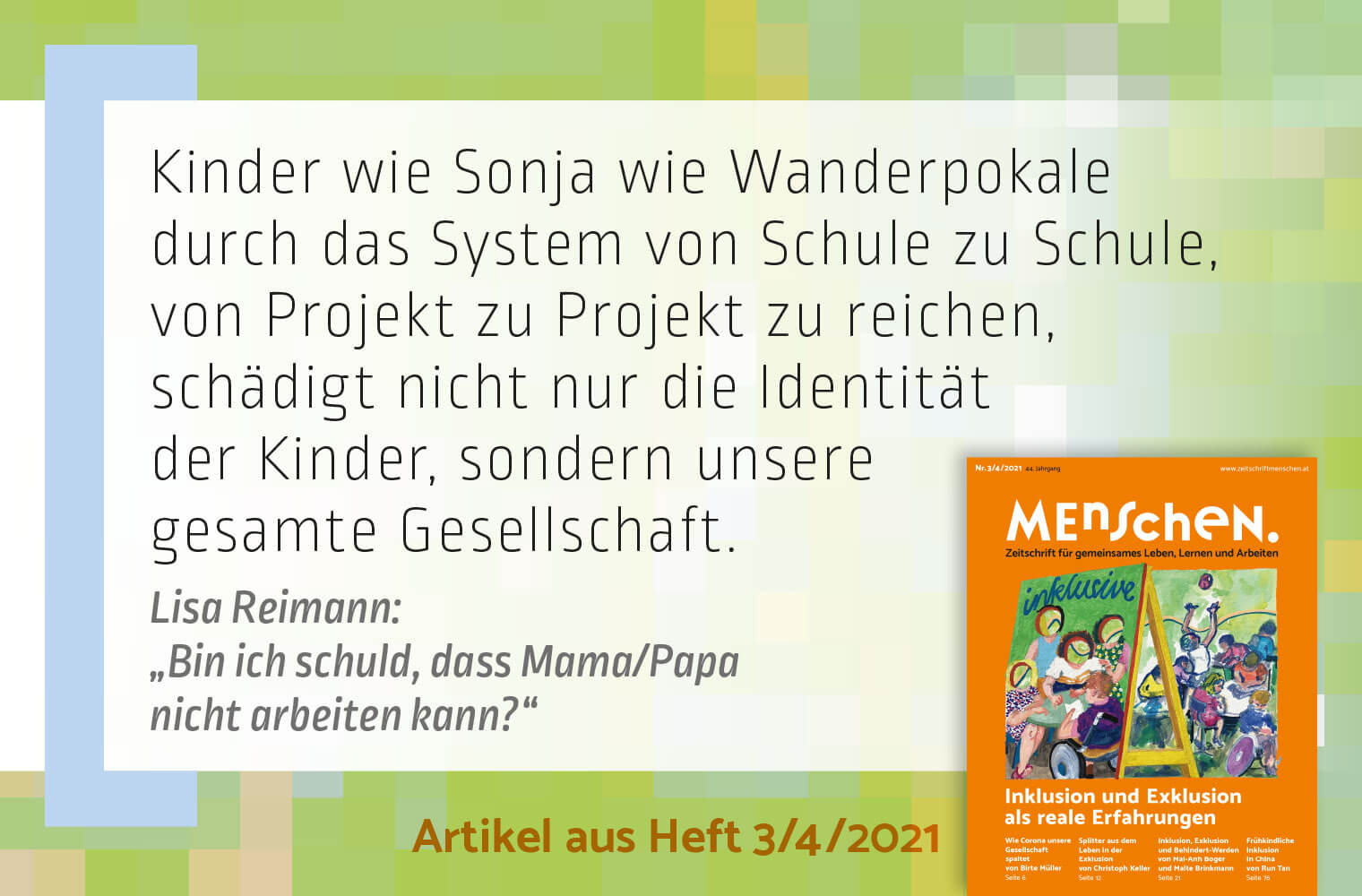
Kinder, die viel Zuwendung brauchen, als Gradmesser für Inklusion.
„Bin ich schuld, dass Mama/Papa nicht arbeiten kann?“
Seit über einem Jahrzehnt ist die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland und Österreich in Kraft. Artikel 24
beschreibt nicht nur das Recht auf inklusive Bildung, sondern fordert die Vertragsstaaten dazu auf, angemessene
Vorkehrungen zur Umsetzung dieses Rechtes zu treffen.
Wir sind noch weit davon entfernt, dass jede Schule vor Ort jedes Kind mit Förderbedarf auf-nimmt. Es mangelt an Personal, Schulassistenz, an angemessenen Räumlichkeiten, Barrierefrei-heit und vor allem an der inklusiven Haltung. Natürlich gibt es sie – die Schulen, die inklusive Bildung täglich engagiert umsetzen. Doch diese Schulen sind rar und sehr begehrt. Die Erfahrung hat auch gezeigt: Solange es Förderschulen gibt, werden sie gefüllt. Von einem echten System-wandel kann weder in Deutschland noch in Österreich die Rede sein.
Gefordert ist die Politik
Die UN-Behindertenrechtskonvention legt die Verantwortung, inklusive Bildung vollständig umzusetzen, in die Hände des Staates. Doch oft sind es die Eltern, die um jeden Zipfel Hilfe kämpfen müssen – sofern sie die Ressourcen dafür haben. Die Benachteiligung und fehlende Unterstützung seitens der Bildungsverwaltungen und der Politik treffen die Familien hart. Gerade Kinder, die Schwierigkeiten mit der Welt haben, und die Welt mit ihnen, sind ein Gradmesser dafür, ob ausreichend Unterstützung für inklusive Bildung vorhanden ist. Suspendierung, Hau-sunterricht, Schulzeitverkürzung, keine Betreuung im Hort, weil das Kind zu „schwierig“ sei und Personal fehlt – viele Eltern von Kindern mit „Verhaltensschwierigkeiten“ kennen das. Auch viele Eltern von Kindern mit einem hohen Pflege- und Unterstützungsbedarf springen ein, wenn das System Schule die Kinder nicht versorgen kann. Es ist nicht selten, dass Eltern deswegen ihren Job aufgeben müssen, wie die folgenden Beispiele von Sonja, Burak und Nina zeigen.
Sonja
Seitdem Sonja die Schule besucht, ist für ihren Vater an eine Weiterbeschäftigung als Handwer-ker nicht zu denken. Viel zu oft muss er sie schon um 13 Uhr oder früher abholen. Wenn Sonja suspendiert wird, bleibt er mit Sonja daheim. Sonja ist oft unter Spannung. Sie hat Schwierigkei-ten, Impulse zu kontrollieren. Die vielen Reize in Kindergruppen überfordern sie. Wenn es dann laut und stressig wird, weiß sie manchmal keinen anderen Weg als zu schlagen – besonders am frühen Nachmittag, wenn sie schon eine ganze Weile aufpassen, zuhören, sich zusammenreißen musste. Sie kann in dem Moment nicht anders. Könnte sie es, würde sie es nicht tun. Der Hort der Schule weigert sich, das Kind zu betreuen. Die Schule will Sonja nicht länger bei sich haben. Neben dem Gefühl „Nicht-dazu-zu-gehören“ ist eine ganze Familie von Armut bedroht.
Schon im Kindergarten fiel Sonja auf. Sie bekam einen Integrationsstatus und wenn Sonja un-ruhig wurde, ging die Erzieherin mit ihr nach draußen, unterstützte Sonja, gab ihr das Gefühl der Anerkennung. Das Kind beruhigte sich und entwickelte sich gut. In der Schule verstärkten sich das Hauen und Treten. Sonja bekommt einen sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich emotionale-soziale Entwicklung. Eine Schulhelferin oder einen Schulhelfer gibt es für Sonja nicht und auch die Möglichkeiten sich zurückzuziehen, wurden weniger. Die Gewaltvorfälle ereignen sich immer auf dem Schulhof in den Pausen oder beim Turnen – immer dann, wenn es unruhiger um Sonja herum wird und sie Ablehnung und Frust nicht regulieren kann. Sie tritt eine Erzieherin. Sie würgt ein anderes Kind. Sie schlägt mit der Faust. Obwohl genau diese Situatio-nen bekannt sind, findet keine 1:1-Betreuung statt. Dadurch wiederholen sich Gewaltmeldungen und Suspendierungen nach dem gleichen Muster – mit der Folge, dass die Sorge und Wut ande-rer Eltern wachsen. Die Direktorin sieht keine Zukunft für Sonja an ihrer Schule – einer Schule mit dem Schwerpunkt Inklusion. Die umliegenden Grundschulen verweisen auf diese Schule und wollen Sonja nicht. Einzig eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen ist bereit, Sonja aufzunehmen.
Dass Sonja in den bekannten Situationen keine permanente 1:1-Betreuung bekommt, wider-spricht dem Recht auf inklusive Beschulung und angemessene Unterstützung. Für Kinder wie Sonja braucht es pädagogische und/oder therapeutische Hilfestellung, um Strategien und alterna-tive Handlungsweisen zu erlernen, sowie eine enge Verzahnung mit der Jugendhilfe und Schul-psychologie. Doch viel zu oft sendete die „inklusive“ Schule der Familie die Botschaft: „Euer Kind ist falsch – ihr seid falsch – Sonja ist bei uns falsch. Mit euch stimmt doch was nicht.“ An-erkennung bleibt auf der Strecke. Sonja spürt den Aufruhr: „Ihr sagt, ich bin schwierig und ge-stört? Dann zeige ich es euch auch.“
Anstatt alles in die Wege zu leiten, um sich von einem Kind wie Sonja zu trennen und es an eine Förderschule zu überweisen, könnte die Schule versuchen, ihren Blickwinkel zu ändern und gleichzeitig ein Mandat an die Bildungsverwaltung artikulieren:
„Da ist ein Kind, auf das wir besonders achtgeben müssen. Ein Kind, das andere verletzen kann, ein Kind, für das wir Personal bereitstellen müssen und vielleicht auch ein Kind, das uns Angst macht, ein Kind, das unser pädagogisches Konzept mit seinem Verhalten in Frage stellt, ein Kind, das uns so sehr fordert, dass wir mit dem bisherigen Alltag nicht weiter machen kön-nen, ein Kind, das uns wütend macht. Deshalb reflektieren wir unsere Haltung, unser Handeln, wir holen uns Unterstützung. Sonja gehört zu uns und wir brauchen mehr Hilfspersonal.“
Gewalt ist schlimm, Faustschläge, Würgen – all das verletzt Menschen, Kinder teilweise sogar schwer. Doch Kinder wie Sonja wie Wanderpokale durch das System von Schule zu Schule, von Projekt zu Projekt zu reichen, schädigt nicht nur die Identität der Kinder, sondern unsere gesamte Gesellschaft. Was wird aus ausgestoßenen Kindern? Welche Botschaft senden wir unseren Kin-dern, wenn andere Kinder, die Schwierigkeiten mit der Welt haben (und die Welt mit ihnen), weggeschickt werden, die Schule verlassen müssen?
Burak
Jeden Tag um die Mittagszeit macht sich Buraks Mutter auf den Weg zur Schule. Sie erreicht die Mensa, drückt Burak einen Kuss auf die Wange, berechnet die Kohlenhydrate, stellt das Insulin ein und geht wieder. Burak hat Diabetes. Die Sonderpädagogik-Verordnung seines Bundeslandes hat zwar festgelegt, dass Schulhelferinnen und -helfer Maßnahmen der Behandlungspflege übernehmen dürfen, wenn sie an einer entsprechenden Schulung teilgenommen haben. Doch seine Schulhelferin kommt zwei Mal die Woche in den ersten Stunden. Zum Mittagessen, wenn Burak ihre Hilfe braucht, ist sie nicht mehr da. Die Schule meint, es gäbe keine anderen Schul-helferinnenstunden für Burak, außerdem sei die Krankenkasse zuständig. Doch zu Zeiten des Fachkräftemangels gibt es für Pflegedienste lukrativere Aufträge als zu einer Schule zu fahren, um dann eine einzige Leistung auszuführen. Kein Pflegedienst übernimmt zu dem Kostensatz die Versorgung von Burak in der Mittagszeit. Erst als die Mutter sich an einen Politiker wendet und viele Briefe geschrieben werden, kann die Mutter arbeiten gehen und Burak wird in der Schule versorgt.
Nina
Anders ist es bei Nina. Ninas Mutter arbeitet bis heute nicht. Trotz aller Informationen war es für die Schule dann doch eine große Überraschung, dass Nina bei Bedarf katheteresiert werden muss. Nina ist Rollstuhlfahrerin und die Blase entleert sich nicht von allein. Wenn die Blase drückt, muss sie mit einem Katheter entleert werden. Wird die Blase nicht entleert, drohen Ent-zündungen. Es gibt auch keinen Rhythmus wie „alle vier Stunden“. Es muss immer jemand da sein, der/die bei Bedarf katheterisieren kann und darf. Bei Schuleintritt stellt die Schule fest: „Wir können das nicht und wir dürfen das nicht. Wir sind ja gar nicht zuständig.“ Die Kranken-kasse ist zuständig. Doch die Kasse finanziert nur die Leistung, nicht die permanente Anwesen-heit einer Pflegekraft. Das Kind auf eine der wenigen Förderschulen zu geben, die über eine eigene Schulkrankenschwester verfügen und am anderen Ende der Stadt liegt, stellt für die Fami-lie keine Lösung dar. Die Eltern möchten das Recht ihres Kindes auf inklusive Beschulung ver-wirklichen. Es soll mit der großen Schwester und den Nachbarskindern auf die Schule vor Ort gehen dürfen. Die einzige Lösung für Nina ist, dass sich die Mutter auf Abruf in der Nähe der Schule aufhält. Die Mutter muss ihren Job kündigen (bei dem sie übrigens nicht unerhebliche Karrierechancen gehabt hätte) und darf den Vormittag (und Mittag) auf Abruf nahe der Schule verbringen.
Eltern springen für den Staat ein
Das Recht auf Inklusion einzulösen, hat Konsequenzen. Diese Konsequenzen tragen nicht etwa der Staat wie in der UN-Behindertenrechtskonvention festgelegt, sondern viel zu oft die Eltern. Die Geschichten von Nina, Burak und Sonja zeigen: Das Recht auf inklusive Bildung und die Sicherstellung der Versorgung stehen auf wackeligen Beinen. Anstatt als Schulbehörde schnell nach Lösungen zu suchen, um die Arbeitslosigkeit der Eltern zu verhindern, wird das Problem auf die lange Bank geschoben. Wie sich die Eltern fühlen, die durch die Schulpflicht ihrer Kin-der in die Arbeitslosigkeit geschickt werden, kann man sich ungefähr vorstellen. Und wie fühlen sich eigentlich Burak, Sonja und Nina, die von allen als „Störfaktor“, als „Kostenträger“ gesehen werden („Bin ich schuld, dass Mama/Papa nicht arbeiten kann?“). Die Kinder spüren die große Unsicherheit um sie herum. Das Recht auf inklusive Bildung sieht vor, dass vom Staat alle an-gemessenen Vorkehrungen, die eine gleichberechtigte Teilhabe ermöglichen, getroffen werden. Doch davon sind wir noch weit entfernt. Wenn eine Bildungsverwaltung wenigstens fragen würde „Was brauchst du Schule, damit jedes Kind gut bei euch sein kann?“, dann wären wir ein kleines Stück weiter.
Lisa Reimann, freie Dozentin
Sie ist Pädagogin und Dozentin für Inklusion. Gemeinsamer inklusiver Unterricht ist für sie die Grundvoraussetzung für eine vorurteilsbewusste und inklusive Gesellschaft, die alle Men-schen teilhaben lässt.
Auf ihrem Blog www.inklusionsfakten.de schreibt Lisa Reimann gegen Vorurteile über inklu-sive Bildung an. Sie ist zudem im Vorstand des inklusiven Kinder- und Jugendvereins Indiwi e.V. und im Beirat der Stiftung Bildung.
www.indiwi.de

